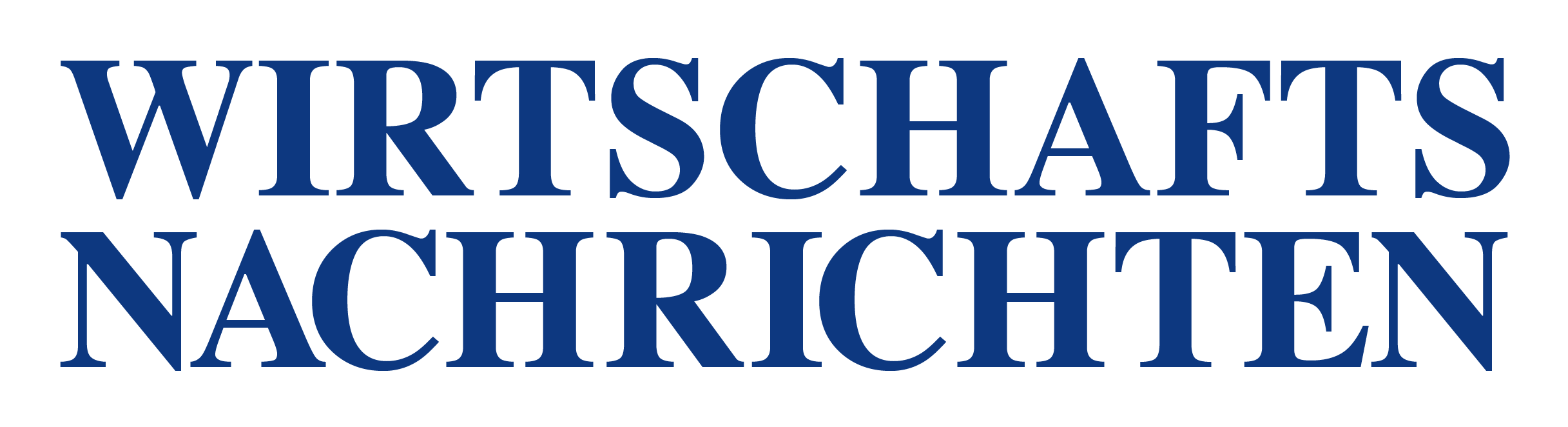Export Tirol : Wie viel Deutschland steckt in Westösterreichs Konjunkturproblem?

Der Industrie und Wirtschaft in Tirol brennen im bilateralen Verhältnis zu Deutschland zwei ganz konkrete Probleme untere den Nägeln.
- © Uwe - stock.adobe.comWenn Deutschland hustet, ist für Österreich die Grippe nicht mehr weit. Dieses Bonmot geistert aktuell wieder in vielen Variationen durch Diskussionen, Reportagen und Analysen. Vor allem aber bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der beiden so ungleichen und doch ähnlichen Nachbarländer.
Deutschland: die größte Volkswirtschaft innerhalb der EU. Österreich: der Zwerg, der sich seit 1995, dem Jahr des EU-Beitritts, ordentlich gemausert hat und zu den wohlhabendsten Ländern der Staatengemeinschaft zählt.
„Österreich ist weniger vom deutschen Konjunkturzyklus abhängig, vielmehr hängen wir gemeinsam mit Deutschland am internationalen Konjunkturzyklus, weil beide die gleichen Märkte bedienen oder über dieselben Lieferketten miteinander verflochten sind“, erklärt Marcus Scheiblecker, Senior Economist und Mitglied der Forschungsgruppe Makroökonomie und öffentliche Finanzen‘ des Wirtschaftsforschungsinstituts.
Lesen Sie auch hier: Westösterreich – Es gilt das Prinzip Hoffnung
Zur geografischen Verdeutlichung: Die Grenzregionen zwischen Österreich und Deutschland erstrecken sich von der Donau im Osten über die Salzach-Inn-Regionen bis zum Bodensee im Westen auf einer Gesamtlänge von über 800 Kilometern.
Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Westen Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Der bilaterale Warenaustausch: Westösterreich und Deutschland
Deutschland ist für die westlichen Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg zum wichtigsten Exportpartner geworden. Grund dafür sind neben der gemeinsamen Grenze vor allem auch die seit langem gewachsenen Wirtschaftsverbindungen.
Salzburgs Exportvolumen nach Deutschland machte 2023 insgesamt 3,8 Milliarden Euro aus und betrug 28 Prozent des gesamten Salzburger Exportvolumens. Zum Vergleich: Auf Platz zwei folgen weit abgeschlagen die USA mit etwas mehr als zehn Prozent.
Das Exportaufkommen Tiroler Unternehmen nach Deutschland ist mit dem der Salzburger vergleichbar. Im Jahr 2022 gingen Waren im Wert von rund 4,9 Milliarden Euro, das sind fast 30 Prozent aller Tiroler Exporte, zum großen Nachbarn.
„Bricht in unserem Nachbarland die Nachfrage aufgrund schwächelnder Wirtschaftsleistung ein, spüren Tiroler Unternehmen diesen Nachfragerückgang sofort, und das nicht nur in den klassischen Industriebereichen der Zulieferbetriebe der deutschen Automobilindustrie. Aufgrund der Stellung Deutschlands als wichtigstem Zielmarkt für Tiroler Produkte sind alle Sektoren der Tiroler Wirtschaft von den negativen Effekten der Rezession in Deutschland betroffen“, so IV-Tirol-Geschäftsführer Michael Mairhofer.
Deshalb ist es entscheidend, die Abhängigkeit durch eine Diversifizierung der Exportmärkte zu verringern. „Neue Märkte in Asien, Nordamerika und Afrika bieten hier ein großes Potenzial", wie es von der Tiroler Industriellenvereinigung heißt.
Auch die Vorarlberger Industriebetriebe sind in hohem Ausmaß vom Exportaufkommen nach Deutschland abhängig, sagt Christian Zoll, Geschäftsführer Industriellenvereinigung Vorarlberg.
Nach Angaben der dortigen Wirtschaftskammer „ist Deutschland mit Abstand Vorarlbergs wichtigster Handelspartner, der im Jahr 2023 allein 28 Prozent der Vorarlberger Exporte (rund 3,7 Milliarden Euro) bezog und 37 Prozent der Importe lieferte (rund 3,5 Milliarden Euro)“. Abschließend heißt es dazu, „wenn unser Nachbar schwächelt, dann tun wir das auch“.
Das gesamtösterreichische Exportvolumen nach Deutschland betrug im ersten Halbjahr 2024 rund 28,3 Milliarden Euro. Das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Exportvolumens. Verglichen mit dem Zeitraum 2023 bedeutet dies jedoch einen Rückgang von rund 7,6 Prozent, „was die allgemeine konjunkturelle Schwächephase widerspiegelt“, wie es von der Wirtschaftskammer Salzburg heißt.
„Die Lohnstückkosten in Österreich sind seit 2019 um 35 Prozent gestiegen, in den restlichen westeuropäischen Ländern aber nur um 20 Prozent.“Wilfried Hopfner, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg
Wie Deutschlands Probleme zu Österreichs werden
Als besonders standortschädlich hat sich die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahre gezeigt. Die ohnehin schon angeschlagene deutsche Automobilindustrie hat wegen der hohen Energiekosten auf dem Weltmarkt ihre Konkurrenzfähigkeit weitgehend eingebüßt.
Österreich wird aufgrund der Verflechtungen über die vielen Zulieferer mit hineingezogen. Durch die räumliche Nähe in den Grenzregionen werden die Fehlentwicklungen stärker wahrgenommen. Die schnell gestiegenen Arbeitslosenzahlen vom Innviertel bis an den Bodensee sprechen eine deutliche Sprache.
Die Wirtschaftskammer Salzburg findet dafür auch deutliche Worte: „Der Reformstau auf beiden Seiten der Grenze wirkt sich bereits nachteilig auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus und auch die leeren Staatskassen beschränken die konjunkturpolitischen Alternativen. Höhere Staatsschulden für ein umfassendes nachfrageorientiertes konjunkturpolitisches Paket sind daher nur beschränkt eine Möglichkeit. Dringend notwendige und längst überfällige Reformen müssen umgesetzt werden, um die wirtschaftliche Dynamik angebotsseitig – beispielsweise durch verbesserte Investitions- und Produktionsbedingungen oder auch Abgabensenkungen auf den Faktor Arbeit – anzukurbeln.“
Die Vorarlberger Wirtschaftskammer sieht das ähnlich: „Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes ist bedroht. Vorarlberg als Exportland lebt nicht vom Heimatmarkt allein. Die Deindustrialisierung, also die Verlagerung heimischer Produktion ins Ausland, hat längst begonnen, das ist ein schleichender Prozess. Die Betriebe setzen alles daran, ihre Mitarbeiter zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. Aber das wird immer schwieriger.“
Zwei Probleme im Österreich-Deutschland-Verhältnis
Für die Industrie und Wirtschaft in Tirol gibt es im bilateralen Verhältnis zu Deutschland zwei ganz konkrete Probleme. Das ist erstens das Jahrhundert-Infrastrukturprojekt Brenner Basistunnel (BBT); und zweitens die deutsche Gasspeicherumlage, die wie ein Zoll auf Gaspreise wirkt.
Was den BBT betrifft, wehren sich jetzt schon auf der Zulaufstrecke Anwohnerbündnisse gegen die derzeitige, eigentlich schon beschlossene Trassenplanung. Neuwahlen und ein möglicher Machtwechsel hin zu einem CDU/CSU-geführten Kanzleramt werden den Baustart jetzt weiter verzögern oder sogar die gesamte Planung der Zulaufstrecken zunichtemachen.
Ohne diese wird der BBT sein Potenzial nicht voll entfalten können, Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Für Tirol, aber auch den bayrischen Grenzraum, bedeutet das weiterhin hohe Verkehrsbelastung ohne wirkliche Aussicht auf Entlastung durch die Inbetriebnahme des BBT. Eine Lose-lose-Situation für Bevölkerung und Wirtschaft auf beiden Seiten der Grenze.
Die zweite offene Baustelle, deren Lösung sich durch die Regierungskrise in Deutschland weiter verzögern dürfte, ist die deutsche Gasspeicherumlage. „Diese Umlage, die wie ein Zoll auf den Gaspreis wirkt, erhöht die Kosten für Tiroler Industriebetriebe unnötig und belastet vor allem energieintensive Branchen stark", sagt Michael Mairhofer, GF der IV Tirol. "Um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu sichern und die Energiepreise auf ein faires Niveau zu bringen, muss die österreichische Politik mit Nachdruck auf deren Abschaffung drängen. Doch auch hier drohen durch das Ende der SPD-FDP-Grünen-Regierung weitere Verzögerungen bei den Verhandlungen."
-
![© IV Tirol/Frischauf Portraitbild von Michael Mairhofer, IV Tirol-Geschäftsführer, lächelnd.]() „Deutschand ist und bleibt unser wichtigster Handelspartner“
„Deutschand ist und bleibt unser wichtigster Handelspartner“Michael Mairhofer, IV Tirol-Geschäftsführer
Stärkung des heimischen Standortes
Die weitgehend verfehlte Standortpolitik der auslaufenden Berliner Ampelkoalition hat in ihrer Auswirkung auf das bilaterale Verhältnis zu Österreich die hiesigen Probleme nicht nur verdoppelt, sondern sie auch noch in einem besonders düstern Licht erscheinen lassen. Der große Bruder hat die hausgemachten österreichischen Probleme nicht abgefedert, sondern größer erscheinen lassen, als sie sind.
Die Lohnstückkosten in Österreich sind seit 2019 um 35 Prozent gestiegen, in den restlichen westeuropäischen Ländern aber nur um 20 Prozent. Das sind untrügliche Zeichen dafür, dass das eigene Haus brennt und nicht das des Nachbarn.
„Unsere Hindernisse sind zu einem guten Teil hausgemacht – sie liegen in der Inflation, überbordender Bürokratie in Verbindung mit hohen Abgaben auf Löhnen und Gehältern“, heißt es dazu von der Vorarlberger Wirtschaftskammer.
Und weiter: "Wer in dieser äußerst angespannten Situation glaubt, überhöhte Gehaltsforderungen stellen zu müssen, hat nicht verstanden, wie alarmierend die Lage ist."
So sieht der WKV-Wachstumspakt folgende fünf Punkte zur Stärkung des Standortes vor: Entlastung der Unternehmen, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Anreize für mehr Arbeit, um die Arbeits- und Fachkräftelücke zu schießen, eine Stärkung des Binnenmarktes durch Technologieoffenheit, Bürokratieabbau und Rohstoffsouveränität, eine engere Verzahnung der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik.
Von Tiroler Seite wird dieser Forderungskatalog durch Michael Mairhofer noch folgendermaßen ergänzt: „Ebenso wichtig ist eine offensive Fachkräftepolitik, die den Arbeitsmarkt aktiviert, internationale Talente anzieht und bürokratische Hürden für qualifizierte Zuwanderung abbaut. Gleichzeitig braucht es wettbewerbsfähige Energiepreise. Kurzfristig kann eine Verlängerung der Strompreiskompensation nach deutschem Vorbild unsere Betriebe entlasten. Langfristig ist der Ausbau erneuerbarer Energien – insbesondere der Wasserkraft – und der Netzinfrastruktur entscheidend, um Versorgungssicherheit und Stabilität zu gewährleisten“.
Die Salzburger Wirtschaftskammer macht abschließend deutlich, dass es wichtig sei, auf eine Diversifikation der Kunden und Märkte zu achten, „um die Abhängigkeit von einem schwächelnden Kunden oder einem schwächelnden Markt auszugleichen. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, sich aus einem Sektor zurückzuziehen und sich neue Betätigungsfelder zu suchen“.
Dieser Artikel wurde erstmals 2024 veröffentlicht.
🔎 Noch mehr Wirtschaftseinblicke?
Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie über aktuelle Themen, spannende Interviews und Trends aus der Wirtschaft immer auf dem Laufenden! 🚀💼