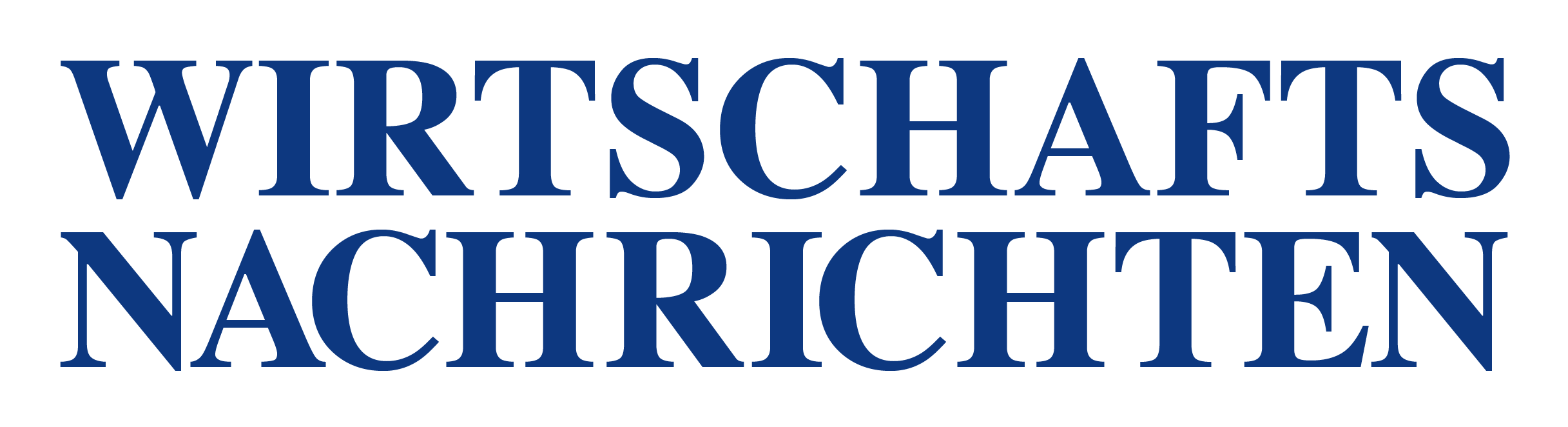Gemeindezusammenlegung Steiermark : Steirische Gemeinden unter Druck: Sind Fusionen die Strategie gegen Schulden?
Inhalt
- Steigende Aufgaben, sinkende Mittel: Wie Gemeinden in Österreich finanziert werden
- Standortpolitik als Schlüssel: Wie Kapfenberg der Rezession trotzt
- Leoben unter Druck: Finanzielle Stabilität durch Haushaltsdisziplin
- Bruck an der Mur: Geringere Einnahmen durch weniger Industrie
- Reformbedarf: Kommunale Finanzierung und Zusammenarbeit
- Schuldenniveau und Strukturprobleme in kleineren Gemeinden
- Zersiedelung als Kostentreiber: Raumplanung wird zur Budgetfrage

Leoben profitiert von zahlreichen großen Betrieben am Standort wie AT&S, Mayer-Melnhof und standortpolitischen Assets wie der Montanuniversität Leoben.
- © Ekaterina SafronovaZehn Jahre nach der letzten großen Gemeindestrukturreform in der Steiermark fusionieren wieder zwei Gemeinden. Aufgrund der zu hohen Schuldenlast, die nicht mehr stemmbar war, schloss sich Söchau in der Südoststeiermark mit seinen 1466 Einwohnerinnen und Einwohnern dem benachbarten und wesentlich finanzkräftigeren Fürstenfeld an.
Von den 286 steirischen Gemeinden haben rund 50 finanzielle Schwierigkeiten. Die Finanzlage hat sich sukzessive in den letzten fünf Jahren verschärft.
Kurzfristige Entspannung gab es nur eine während der Corona-Pandemie durch die so genannte Gemeindemilliarde als Unterstützungspaket vom Bund.
Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Süden Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
-
![© Paller portrait von Andrea Winkelmeier, Bürgermeisterin Bruck an der Mur]() „Besonders wichtig sind uns Kooperationen mit Nachbargemeinden, um gemeinsam die Region zu stärken und Synergieeffekte zu nutzen“
„Besonders wichtig sind uns Kooperationen mit Nachbargemeinden, um gemeinsam die Region zu stärken und Synergieeffekte zu nutzen“Andrea Winkelmeier, Bürgermeisterin Bruck an der Mur
Steigende Aufgaben, sinkende Mittel: Wie Gemeinden in Österreich finanziert werden
Gemeinden stellen in Österreich die unterste Gebietskörperschaft neben Land, Bezirk und Bund dar. Sie erhalten ihre Finanzierung grundsätzlich über die Ertragsanteile von den Ländern, die sich nach der Höhe der Steuereinnahmen des Bundes bemessen und im Rahmen des Länderfinanzausgleiches vom Bund weiterverteilt werden.
Weiters generieren Gemeinden Einnahmen durch die Kommunalsteuer, welche von Betrieben abgeführt wird sowie durch Abgaben, die sie für ihre Dienstleistungen einheben.
Die Aufgabenfülle der Gemeinden ist aber inzwischen enorm. Sie reicht von Investitionen in Infrastruktur, Bürgerservice, Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge wie Kanal, Wasser und Müll sowie über sozialpolitische Aufgaben und Betreibung von Betreuungseinrichtungen.
Steigende Infrastrukturkosten belasten neben immer höheren Personalausgaben und Sozialleistungen am meisten die Gemeindekassen. Es liegt quasi ein ständige Investitionsdruck auf den Gemeinden.
Die Erhaltung von Straßen, Wasser- und Kanalnetzen sowie Gemeindegebäuden ist aufgrund der teuren Baukosten und der Inflation immer kostenintensiver geworden. Irgendwann wird die Schuldenlast zu groß und eine Gemeinde geht quasi in Insolvenz, was eine Verwaltung durch das Land bedeutet.
Aber bereits davor sind viele Gemeinden, die nur mehr schwer einen ausgeglichenen Haushalt bilanzieren können, nicht mehr handlungsfähig, um sich weiterzuentwickeln.
-
![© Stadt Kapfenberg Portrait Matthäus Bachernegg, Bürgermeister Kapfenberg]() „Wir profitieren heute vom jahrzehntelangen Aufbau als Technologie-Standort. Kapfenberg steht dadurch wirtschaftlich solide da."
„Wir profitieren heute vom jahrzehntelangen Aufbau als Technologie-Standort. Kapfenberg steht dadurch wirtschaftlich solide da."Matthäus Bachernegg, Bürgermeister Kapfenberg
Standortpolitik als Schlüssel: Wie Kapfenberg der Rezession trotzt
Betriebsansiedelung und aktive Standortpolitik ist oft das einzige Mittel, um über ein höheres Kommunalsteueraufkommen, mehr Einnahmen für die Gemeindekassen zu generieren. Schwächelt die Wirtschaft, merken dies die Kommunen sofort.
Es zeigt sich, wer in den letzten Jahren in aktive Standortpolitik investiert hat, ist resilienter. Das zeigt auch ein Blick auf die steirische Industriestadt Kapfenberg.
„Wir setzen auf eine starke Unternehmens-Basis mit rund 1.200 Betrieben in der Stadt, on Top befinden sich die Weltmarktführer wie Pankl, voestalpine Böhler Edelstahl oder Exel Composites. Das Kommunalsteueraufkommen ist stabil“, berichtet dazu etwa Kapfenbergs Bürgermeister Matthäus Bachernegg.
Kapfenberg investierte in den letzten Jahren gezielt in Standortförderung, Green-Tech-Projekte und Bildungsinitiativen, um langfristige wirtschaftliche Stabilität zu sichern.
„Wir profitieren heute vom jahrzehntelangen Aufbau als Technologie-Standort. Kapfenberg steht dadurch wirtschaftlich solide da. Kooperationen – etwa mit regionalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen – sind zentrale Zutaten, um Fachkräfte zu sichern. Mit den Arbeitsplätzen halten wir auch die Menschen in der Region, weil sie erkennen, wie lebenswert es in Kapfenberg und Umgebung ist“, erläutert Bachernegg warum sich die Standortpolitik der letzten Jahre jetzt in der Rezession bezahlt macht.
Lesen Sie auch hier: Nachhaltiges Standortmanagement mit neuen Impulsen dank Standortdatenbank
Dennoch geht die wirtschaftlich angespannte Gesamtsituation auch an Kapfenberg nicht spurlos vorbei.
„Wir müssen in der Stadt bei Investitionen in Projekte schon genauer hinschauen. Kapfenberg bleibt trotz Rezession trotzdem ein Innovationsmotor“, bekräftigt der Stadtchef.
Im engen Austausch mit FH Joanneum und den Betrieben beschäftigt man sich mit Themenfeldern wie smarte Produktion, Wissenstransfer und Forschung, um den Standort wettbewerbsfähig zu halten und zukunftsfit zu halten.
-
![© Freisinger portrait Kurt Wallner, Bürgermeister Leoben]() „Die Rezession senkt die Kommunalsteuereinnahmen, da Unternehmen weniger Gewinn machen und Arbeitsplätze gefährdet sind. Das belastet die Budgets spürbar“
„Die Rezession senkt die Kommunalsteuereinnahmen, da Unternehmen weniger Gewinn machen und Arbeitsplätze gefährdet sind. Das belastet die Budgets spürbar“Kurt Wallner, Bürgermeister Leoben
Leoben unter Druck: Finanzielle Stabilität durch Haushaltsdisziplin
In der Nachbarstadt Leoben ist die Lage ähnlich. Dort profitiert man ebenfalls von zahlreichen großen Betrieben am Standort wie AT&S, Mayer-Melnhof und standortpolitischen Assets wie der Montanuniversität Leoben.
Doch auch in der Montanstadt ist Haushaltsdisziplin angesagt. „Leoben reagiert mit strikter Haushaltsdisziplin, prüft Investitionen noch genauer und optimiert die administrativen Abläufe. Gleichzeitig setzen wir auf wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, um Unternehmen und Arbeitsplätze in der Stadt zu halten. So bleiben wir trotz engerer Spielräume finanziell stabil“, berichtet Leobens Bürgermeister Kurt Wallner.
Die Rezession dämpfte grundsätzlich Investitionen und Beschäftigung, was den Standort Leoben herausfordert.
„Wir setzen daher auf aktive Wirtschaftsförderung, beschleunigte Genehmigungen und gezielte Infrastrukturprojekte. Durch enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und universitärer Forschung stärken wir Innovation und sichern Arbeitsplätze“, beschreibt Wallner das Maßnahmenpaket seiner Stadt.
So bleibe Leoben trotz Krisen attraktiv und wettbewerbsfähig.
Bruck an der Mur: Geringere Einnahmen durch weniger Industrie
Mit etwas weniger Industrie aber im Verhältnis mit mehr öffentlichen Institutionen und Körperschaften gesegnet ist hingegen Bruck an der Mur.
Da dort nicht so viele große internationale Unternehmen ansässig sind, wie in den Nachbarstädten, spürt man dies einnahmenseitig stärker.
„Die aktuelle Konjunkturflaute stellt auch Bruck an der Mur vor finanzielle Herausforderungen. Wir haben strukturell geringere Kommunalsteuereinnahmen als zum Beispiel unsere Nachbarstädte, da wir weniger Industriebetriebe und viele große Unternehmen wie LKH, Bezirkshauptmannschaft und Bezirksgericht haben, die keine Kommunalsteuer zahlen“, berichtet Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier.
Um die Auswirkungen der Flaute abzufedern, setzt Bruck an der Mur daher ebenfalls auf striktes Haushalten und eine sorgfältige Prüfung aller Ausgaben.
„Gleichzeitig bemühen wir uns, neue Einnahmequellen zu erschließen und die bestehenden zu optimieren“, so Winkelmeier. Dazu gehöre die Förderung von Neuansiedlungen genauso wie die Verbesserung der Infrastruktur und der Attraktivität unseres Standortes für Unternehmen und Fachkräfte.
„Besonders wichtig sind uns dabei Kooperationen mit Nachbargemeinden, um gemeinsam die Region zu stärken und Synergieeffekte zu nutzen“, bekräftigt Winkelmeier weiters.
Um die Standortentwicklung weiter voranzutreiben, sei zudem geplant, einen Innenstadtkoordinator zu installieren, der sich zentral um die Belange der Innenstadt kümmert.
„Ich bewerte die Lage des Wirtschaftsstandortes Bruck an der Mur trotz der aktuellen Herausforderungen positiv. Wir haben viele Stärken, darunter unsere zentrale Lage, eine gute Infrastruktur und ein attraktives Lebensumfeld“, so Winkelmeier abschließend.
Reformbedarf: Kommunale Finanzierung und Zusammenarbeit
Starke Wirtschaftszentren tun sich tendenziell leichter mit der Krise umzugehen als Gemeinden mit weniger Kommunalsteuereinnahmen. Damit der Handlungsspielraum aber wieder steige, brauche es generell Reformen wie Leobens Bürgermeister Kurt Wallner auch deutlich macht und an Bund und Land appelliert.
„Wir fordern vom Bund und Land eine faire Anpassung der uns zufließenden Finanzmittel, um Städte und Gemeinden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu entlasten und kommunale Leistungen abzusichern. Die Rezession senkt die Kommunalsteuereinnahmen, da Unternehmen weniger Gewinn machen und Arbeitsplätze gefährdet sind. Das belastet die Budgets spürbar“, so Leobens Stadtchef.
Gemeindefusionen und Kooperationen bieten seiner Ansicht nach große Chancen für mehr Effizienz und Kosteneinsparungen.
„Die steigenden infrastrukturellen Kosten stellen viele Gemeinden vor Herausforderungen. Kooperationen in Bereichen wie Verwaltung, Infrastruktur und Dienstleistungen ermöglichen es, Synergien zu nutzen und Ressourcen effizienter einzusetzen, ohne die Eigenständigkeit aufzugeben“, ist Wallner grundsätzlich überzeugt.
Für mehr Kooperation müsse es aber nicht gleich eine Gemeindefusion sein. Diese halte er nicht für zwingend erforderlich, könne aber generell langfristig ein sinnvoller Schritt sein, um die kommunale Leistungsfähigkeit zu sichern.
Schuldenniveau und Strukturprobleme in kleineren Gemeinden
Durchschnittlich haben steirische Gemeinden eine Verschuldung von 2.684 Euro pro Einwohner. Graz mit rund 5.700 Euro Schulden pro Kopf ist ein Ausreißer nach oben.
Laut neuen Berechnungen des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) haben Gemeinden unter 5000 Einwohner eine tendenziell höhere Verschuldung als Gemeinden ab 10.000 Einwohner, was dafür spricht, dass kleinere Gemeinden mit weniger Erträgen stärker finanziell belastet werden.
Gemeindefusionen und die Schaffung größerer Gemeindeeinheiten würden demnach mehr finanzielle Spielräume eröffnen.
Zersiedelung als Kostentreiber: Raumplanung wird zur Budgetfrage
Auffallend ist aber auch, dass Gemeinden mit starker Zersiedelung tendenziell höhere Schulden haben, wie der Gemeindeschuldenatlas der Statistik Austria aufzeigt.
Das ist übrigens kein Phänomen, das auf die Steiermark beschränkt ist, sondern trifft auf alle Bundesländer zu. Sind aufgrund von weit verteilten Siedlungsstrukturen eine hohe Anzahl von Straßen- und Leitungskilometern (Kanal, Wasser) notwendig, so erhöhen sich auch die Erhaltungskosten einer Gemeinde.
Kompakte Raumordnung ist also budgetwirksam.
🔎 Noch mehr Wirtschaftseinblicke?
Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie über aktuelle Themen, spannende Interviews und Trends aus der Wirtschaft immer auf dem Laufenden! 🚀💼