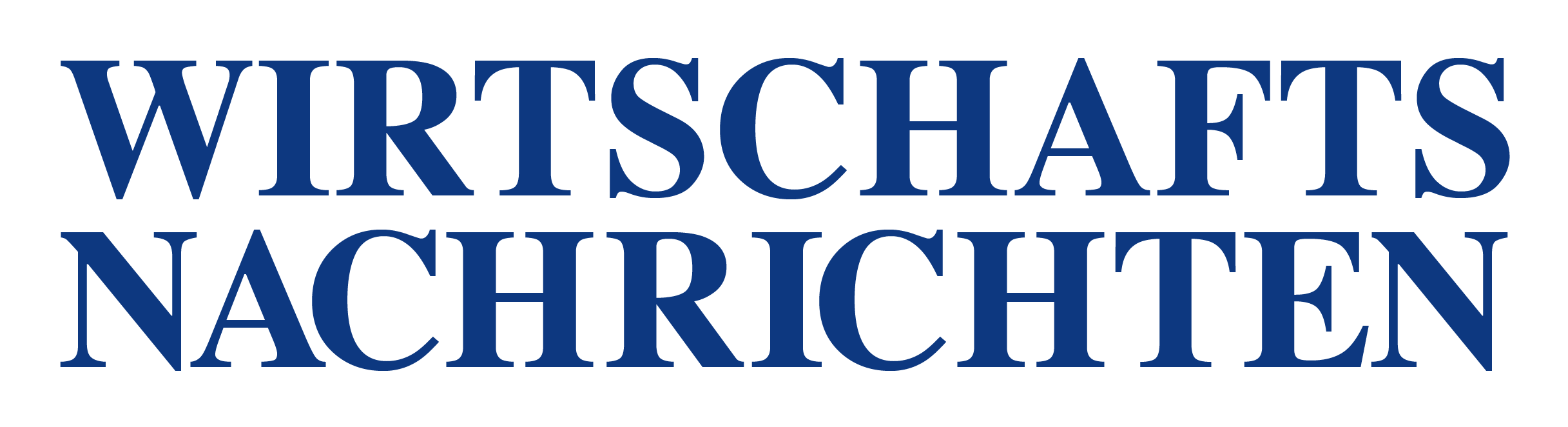Waldfonds Österreich : Waldfonds: Erfolgsmodell oder ineffiziente Förderung?

Bereits 2022 hatte der Rechnungshof kritisiert, dass mehr als die Hälfte der schutzwaldbezogenen Förderungen für den Bau von Forststraßen verwendet wurden.
- © RaabklammDer österreichische Waldfonds wurde 2020 unter der damaligen Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ins Leben gerufen und hat seither europaweit Aufmerksamkeit erregt.
Ursprünglich als Reaktion auf schwere Waldschäden durch den Borkenkäfer und schlechte Holzpreise konzipiert, wurde er von der gesamten Forst- und Holzwirtschaft als wichtige Investition in die Zukunft angesehen.
Laut Herbert Jöbstl, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs, hat der Fonds entscheidend dazu beigetragen, dass Schadholz umfassender genutzt wird als in den Jahren zuvor. Zudem wurden Investitionen in die Holzverwendung forciert, darunter Universitätslehrstühle mit Schwerpunkt Holzbau, regionale Holzfachberater und ein CO₂-Bonus für Holzbauten.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel plädiert die Holzindustrie für eine Verlängerung des Waldfonds.
„Der Waldfonds unterstützt den klimafitten Waldumbau und schafft zugleich Anreize für die Holzverwendung, wodurch Wertschöpfung generiert und Arbeitsplätze gesichert werden“, so Jöbstl.
Die Forst- und Holzwirtschaft trägt jährlich 28 Milliarden Euro zur Wertschöpfung bei, sichert 320.000 Arbeitsplätze – sieben Prozent der Gesamtbeschäftigung – und generiert Steuereinnahmen von 12 Milliarden Euro jährlich.
Rechnungshof übt deutliche Kritik
Trotz dieser positiven Aspekte bemängelt der Rechnungshof in seinem aktuellen Prüfbericht erhebliche Mängel in der Umsetzung des Waldfonds. Die Förderungen wurden mit der Covid-19-Pandemie, Borkenkäferschäden und schlechten Holzpreisen begründet – doch laut Rechnungshof lag der ursprünglichen Dotierung von 350 Millionen Euro im Jahr 2021 keine umfassende Bedarfsanalyse zugrunde.
Bis Ende 2023 wurde das Budget auf 450 Millionen Euro erhöht, ohne dass die Mittelaufstockung nachvollziehbar begründet wurde.
Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft die mangelnden Kontrollmechanismen. Die mit der Abwicklung beauftragten Bundesländer hatten einen weitreichenden Gestaltungsspielraum, doch es fehlten wirksame risikobasierte Kontrollverfahren.
Zudem basierte die Förderberechnung auf Standardkostensätzen, die nicht zwingend mit den tatsächlichen Fördervoraussetzungen übereinstimmten, wodurch Überförderungen nicht ausgeschlossen werden konnten.
Besonders in Vorarlberg fiel auf, dass vor allem Förderungen genutzt wurden, die zugleich Erlöse aus Holzverkäufen ermöglichten.
Intransparente Vergabe und fehlende Schutzwald-Fokussierung
Ein weiteres Problem war die mangelnde Transparenz in der Vergabe der Mittel. Die Rechnungshofprüfer kritisieren, dass die Zahlungsmeldungen der Länder Kärnten, Tirol und Vorarlberg bei Rahmenanträgen nur auf die Antragsteller, nicht aber auf die tatsächlichen Förderempfänger bezogen waren. Dadurch blieb unklar, wer von den 17 Millionen Euro an Förderungen in diesen Ländern profitierte.
Der Bericht hebt zudem hervor, dass das Landwirtschaftsministerium es versäumt habe, im Waldfonds einen deutlichen Fokus auf die Verbesserung des Schutzwaldes zu legen.
Besonders in der Steiermark sei mit Steuergeld deutlich gewissenhafter umgegangen worden, während Vorarlberg von den Vorgaben der Sonderrichtlinie abwich. Bereits 2022 hatte der Rechnungshof kritisiert, dass mehr als die Hälfte der schutzwaldbezogenen Förderungen für den Bau von Forststraßen verwendet wurden, während weniger als 50 Prozent tatsächlich der langfristigen Erhaltung der Schutzwälder zugutekamen.
Wirtschaftliche Bedeutung der Forstwirtschaft
Österreich verfügt über eine Waldfläche von rund vier Millionen Hektar – etwa 48 Prozent der Staatsfläche. Davon sind 81 Prozent in Privatbesitz, während 19 Prozent von den Österreichischen Bundesforsten, Ländern und Gemeinden betreut werden.
Laut dem "Grünen Bericht 2024" des Landwirtschaftsministeriums stiegen die Preise für forstwirtschaftliche Erzeugnisse im Jahr 2023 um 2,7 Prozent. Der Preis für einen Festmeter Blochholz Fichte/Tanne, Klasse B, lag bei durchschnittlich 102,63 Euro.
Während Umweltorganisationen wie Greenpeace den massiven Ausbau des Forststraßennetzes – das mit 218.000 Kilometern inzwischen das reguläre Straßennetz übertrifft – kritisch sehen, betonen Interessenvertretungen wie die Land&Forst Betriebe Österreich die Bedeutung des Waldfonds für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Präsident Konrad Mylius warnt, dass eine Infragestellung des Waldfonds die Realität der Klimakrise ignoriere.
Das könnte Sie auch interessieren: Entwaldungsverordnung – Lichtung des Bürokratiedschungels?
Fazit: Weiterentwicklung oder Reform notwendig?
Die Debatte um den Waldfonds zeigt zwei gegensätzliche Perspektiven. Während die Holzindustrie die positiven wirtschaftlichen Impulse betont und eine Fortführung des Fonds fordert, mahnt der Rechnungshof mehr Transparenz, effizientere Mittelverwendung und eine gezieltere Ausrichtung auf den Schutzwald an.
Ob der Waldfonds in seiner jetzigen Form verlängert oder grundlegend reformiert wird, bleibt abzuwarten. (apa/red)
🎙️ Wirtschaft im Ohr – Ihr Wissensvorsprung! 🚀
Jetzt den neuen Wirtschafts-Nachrichten Podcast entdecken: Aktuelle Trends, Expert:innen-Insights & spannende Analysen – kompakt & auf den Punkt. 🎧
🔊 Jetzt reinhören: wirtschafts-nachrichten.at/podcasts