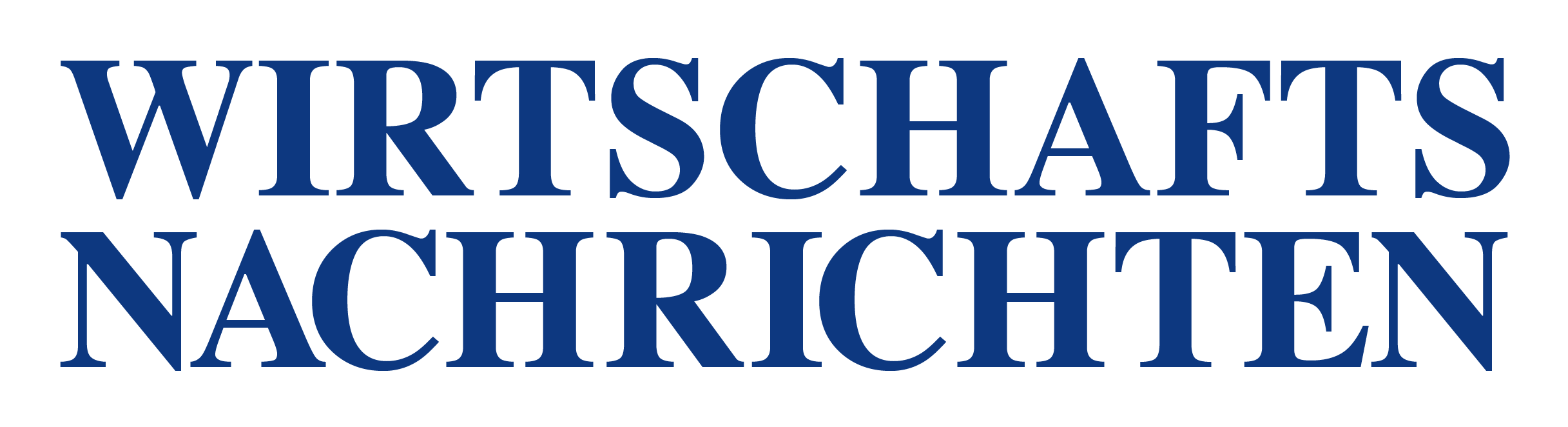Österreichische Computergesellschaft : KI in der Gesellschaft und Wirtschaft – wie sich Ausbildung verschiebt
Inhalt

Vl.: Moderator und OCG Präsident Wilfried Seyruck mit den KI-Experten und OCG Vorstandsmitgliedern Harald Leitenmüller, CTO von Microsoft Österreich, Wolfgang Pree, Informatik-Professor an der Universität Salzburg, und Peter Reichstädter, CIO in der Parlamentsdirektion in Wien.
- © Barbara WirlDie Österreichischen Computergesellschaft (OCG) lud zu ihrem 50-jährigen Bestehen zum Festakt in der TU Wien. Vor rund 200 Gästen wurden Einschätzungen zum Thema Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft geteilt.
Unter der Leitung von OCG-Präsident Wilfried Seyruck diskutierten Harald Leitenmüller (CTO von Microsoft Österreich), Wolfgang Pree (Informatik-Professor an der Universität Salzburg) und Peter Reichstädter (CIO der Parlamentsdirektion Wien) über Chancen, Risiken und die gesellschaftliche Verantwortung im Umgang mit KI.
Seyruck betonte die Bedeutung europäischer Eigenständigkeit in digitalen Schlüsseltechnologien. Vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz dürfe man sich von US-Entwicklungen nicht einschüchtern lassen: „Wir können das in Europa auch."
Auch die zunehmende Fähigkeit von Computern, den Menschen zu verstehen, wurde diskutiert – ebenso wie die Bedeutung frühzeitiger Aufklärung über demokratiegefährdende KI-Anwendungen. Die OCG könne dabei als Akteur zunehmend an Relevanz gewinnen.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Potenziale der KI – und ein wachsendes Risiko
„Wir haben alle keine Ahnung, was uns bevorsteht. Wir haben mit der KI ein unerwartetes Geschenk bekommen, auf das wir nicht vorbereitet sind“, sagte Wolfgang Pree.
Das Potenzial sei enorm – aber auch die möglichen negativen Folgen. Die Künstliche Intelligenz Ausbildung an Universitäten habe sich bereits stark gewandelt. Studierende könnten mit Hilfe von KI deutlich komplexere Aufgaben in kürzerer Zeit bearbeiten.
Ein Beispiel sei Replit AI. Auf Replit.com könnten binnen Stunden Programme entwickelt werden, an denen zuvor ein 3-köpfiges Team ein ganzes Semester gearbeitet habe, erklärte Pree.
KI verändert die Ausbildung – und vielleicht sogar das Studium selbst
Die fortschreitende Entwicklung führe laut Pree dazu, dass Informatik für eine breitere Zielgruppe zugänglich werde. Die Ausbildung verschiebe sich vom reinen Programmieren hin zum kompetenten Umgang mit KI-Werkzeugen.
„Wenn nicht mehr das Programmieren im Mittelpunkt des Informatik-Studium stehen wird, sondern der versierte Umgang mit KI-betriebenen Codegeneratoren gelehrt wird, sieht das Studium völlig anders aus. Vielleicht gehören wir dann bald zu den Erziehungswissenschaften?“, so Pree.
Auch Microsoft-CTO Leitenmüller sieht eine radikale Veränderung. Bisher seien bei Excel nur etwa drei Prozent der Funktionen genutzt worden. Mithilfe von KI könnten nun wesentlich mehr Möglichkeiten erschlossen werden.
„Das Spielchen hat sich umgedreht. Der Mensch lernt nicht mehr, den Computer zu verstehen, sondern der Computer lernt, den Menschen zu verstehen“, erklärte Leitenmüller.
Daraus folge ein ethischer Auftrag: Der Zugang zu KI müsse allen offenstehen, um eine technologische Kluft („Artificial Intelligence Divide“) zu vermeiden.
KI im Parlament: Einsatz, Datenschutz und Desinformation
Auch in der öffentlichen Verwaltung ist der Einsatz von KI längst Thema. CIO Peter Reichstädter berichtete von laufenden Kooperationen mit internationalen Parlamenten, etwa beim Einsatz von Speech-to-Text-Systemen zur Protokollierung.
Datenschutz und IT-Sicherheit hätten jedoch höchste Priorität, wie der gescheiterte Versuch gezeigt habe, 2019 ein KI-Tool wie IBM Watson im österreichischen Parlament zu nutzen.
Gerade im politischen Umfeld sei es entscheidend, den Zusammenhang von KI, Desinformation und demokratischer Stabilität ernst zu nehmen.
„Wir haben gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology schon vor der Nationalratswahl 2017 konkrete Aufklärungsarbeit über die Gefahren von Fake-News und Fake-Videos gestartet“, so Reichstädter.
Frühzeitige Aufklärung und digitale Bildung in der Schule
Auch in der schulischen Bildung sieht Reichstädter dringenden Handlungsbedarf. „Wir sollten in den Schulen schon ganz früh starten, das Problembewusstsein für Manipulationen zu schaffen und die Fähigkeit zu vermitteln, Falschinformationen zu erkennen“, forderte er.
Hier komme der Österreichischen Computergesellschaft als National Operator für den ICDL (vormals Europäischer Computerführerschein) eine zentrale Rolle zu. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Künstliche Intelligenz Ausbildung und digitalen Kompetenzen könne die OCG wichtige Impulse in der Lehre setzen.
Österreich liegt laut Reichstädter international auf Rang zwei bei der Verbreitung von ICDL-Zertifikaten – eine gute Basis für positive Wirkung.
„Mit dieser Reichweite können wir einen positiven Impact schaffen“, betonte Wolfgang Pree und plädierte dafür, möglichst viele Menschen mit KI-Anwendungen vertraut zu machen: „Wir müssen Ängste nehmen und Bewusstsein schaffen.“
Zwischen Euphorie und Ernüchterung: KI als wirtschaftlicher Faktor
Leitenmüller, der sich selbst als Mutmacher sieht, betonte: Österreich habe den Anschluss nicht verpasst. Trotz eines Überangebots an Start-ups im KI-Bereich sei der Markt noch nicht konsolidiert.
Viele Geschäftsmodelle seien aufgrund drastisch gesunkener Modellkosten nicht mehr tragfähig.
„Die Konsolidierung des Marktes hat noch gar nicht begonnen“, warnte Leitenmüller und sprach sich für fundierte Grundlagenbildung und stabile Rahmenbedingungen aus. „Wir brauchen Experten mit fundierten Grundkenntnissen der Materie, die gute Rahmenbedingungen für die gesamte KI-Entwicklung schaffen.“
🔎 Noch mehr Wirtschaftseinblicke?
Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie über aktuelle Themen, spannende Interviews und Trends aus der Wirtschaft immer auf dem Laufenden! 🚀💼