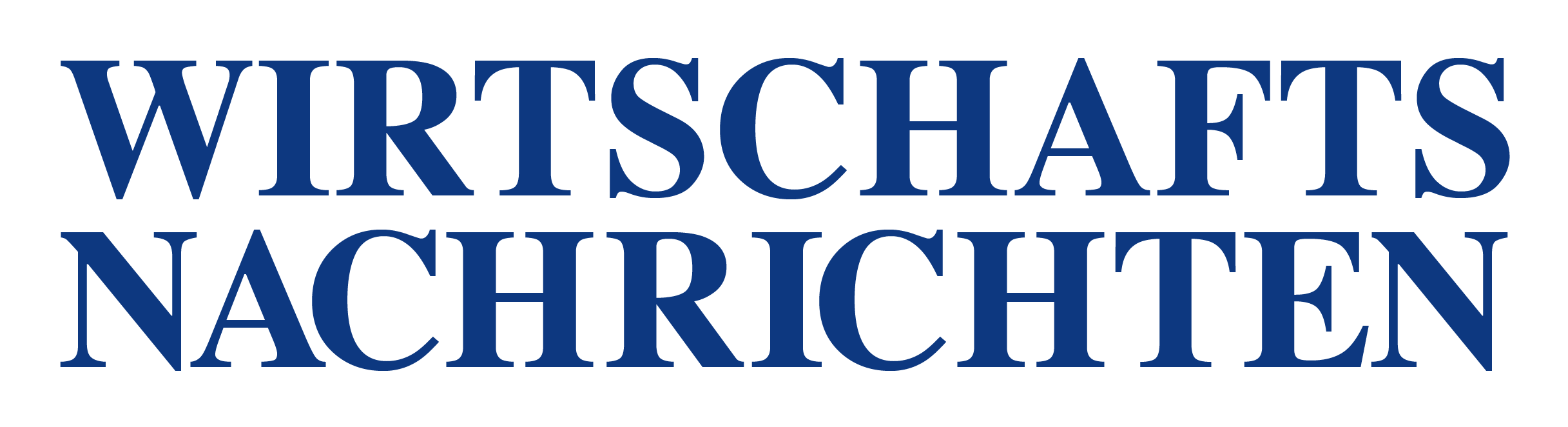Erneuerbare Energie Österreich : Kärnten: Diskussion um Windkraft und Erneuerbaren-Ausbau – Klimaziele im Fokus
Inhalt
- Wie viel Erneuerbare Energie braucht Österreich?
- Infobox Erneuerbare Energien
- Vernunft statt Ideologie: Energiebranche fordert Planungssicherheit
- Stolpersteine beim Ausbau der Erneuerbaren in Kärnten
- Hitzige Diskussionen um Windkraft in Kärnten
- Verhärtete Fronten nach Kärntner Volksbefragung
- Anfechtung der Volksbefragung

Der Erneuerbaren-Ausbau benötigt einen Umfang von 39 TWh zwischen 2020 und 2030, wobei je 21 TWh Stromerzeugung auf Photovoltaik und Windkraft entfallen.
- © Hip.hubBis 2040 soll Österreich Klimaneutralität erreicht haben und als „Klimaschutzvorreiter in Europa“ positioniert sein. Die vor fünf Jahren gegründete türkis-grüne Regierung formulierte zudem das Ziel, die „Stromversorgung bis 2030 auf 100 Prozent (national bilanziell) Ökostrom bzw. Strom aus erneuerbaren Energieträgern umzustellen.
Dieses Ziel erfordert einen Ausbau der Erneuerbaren um 27 Terrawattstunden. Diese setzen sich durch den Ausbau von Photovoltaik im Ausmaß von 11 TWh zusammen, bei Windkraft beträgt das Ausbauziel zehn und bei Wasserkraft fünf TWh, auf Biomasse entfällt eine TWh.
Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Süden Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Diese Ausbauziele wurden auch im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) festgehalten, welches im Juli 2021 im Parlament beschlossen wurde.
Der österreichische Netzinfrastrukturplan (ÖNIP), welcher 2024 beschlossen wurde, beinhaltet bereits geänderte Prognosen zum Strombedarf, welcher auch Anpassungen beim Ausbau notwendig macht.
-
![© VERBUND Portraitfoto von Michael Strugl, Vorsitzender des Vorstands VERBUND]() „Egal wer regiert, an einem Ausbau von Erzeugung, Netz und Speichern führt kein Weg vorbei“
„Egal wer regiert, an einem Ausbau von Erzeugung, Netz und Speichern führt kein Weg vorbei“Michael Strugl, Chef des Stromkonzerns Verbund
Wie viel Erneuerbare Energie braucht Österreich?
Nach diesen neueren Berechnungen benötigt der Erneuerbaren-Ausbau einen Umfang von 39 TWh zwischen 2020 und 2030, wobei je 21 TWh Stromerzeugung auf Photovoltaik und Windkraft entfallen.
Das entspricht einer Verdoppelung gegenüber den im EAG formulierten Ausbauzielen. Für den Zeitraum von 2030 bis 2040 wird sogar von einem notwendigen Ausbau im Umfang von insgesamt 70 TWh an zusätzlicher erneuerbarer Energie ausgegangen.
Trotz dieser weitreichenden Beschlüsse sind andere wichtige Vorhaben wie das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), das Erneuerbare Gase Gesetz (EGG) oder das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) unter Schwarz-Grün zwar verhandelt, jedoch nicht beschlossen worden.
Infobox Erneuerbare Energien
Wussten Sie, dass …
- Nach neueren Berechnungen der Erneuerbaren-Ausbau einen Umfang von 39 TWh zwischen 2020 und 2030 betragen muss.
- Die beliebteste Form der erneuerbaren Energieerzeugung wieder die Photovoltaik gefolgt von Kleinwasserkraft und Windkraft ist
- Die Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung auf Photovoltaikanlagen Einsparungen im Umfang von 175 Millionen Euro bringen soll
- Der Strombedarf der energieintensiven Industrie in Kärnten sich bis 2040 verdoppeln wird.
Vernunft statt Ideologie: Energiebranche fordert Planungssicherheit
Welcher Weg mit einer neuen Bundesregierung beschritten wird, beschäftigt auch die Energiebranche.
„Egal wer regiert, an einem Ausbau von Erzeugung, Netz und Speichern führt kein Weg vorbei“, sagte der Chef des Stromkonzerns Verbund, Michael Strugl, der zurzeit auch Präsident des Branchenverbandes der Energiewirtschaft Österreich Energie ist, im Ö1-Mittagsjournal Anfang Jänner.
Der weitere Ausbau ist keine „ideologische Frage, sondern eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft“, so Strugl weiter.
Sein Rat an die Politik ist es auch, am angestrebten Ziel der Klimaneutralität 2040 festzuhalten, um Planungssicherheit für die Unternehmen zu gewährleisten.
„Was wir brauchen, ist ein verlässlicher Pfad, auf den wir dann setzen können für unsere Investitionen. Diese Stabilität, diese Rechtssicherheit, diese Planungssicherheit, das ist das Entscheidende für uns“, so der Experte im Mittagsjournal weiter.
Zudem warnt er vor Strafzahlungen der EU, die bei Nichterreichen der Klimaziele fällig würden. Weiters weist er auf Klimaschäden hin, die in Österreich bereits jetzt rund eine Milliarde Euro jährlich ausmachen. Berechnungen zufolge können sie bis zum Ende des Jahrzehnts auf vier bis fünf Milliarden Euro anwachsen. Klimaanpassungskosten in der Größenordnung von 1,7 Milliarden Euro sind da noch nicht eingerechnet.
Auch ist für den Energieexperten klar, dass Klimaschutz auch für die nächste Bundesregierung eine hohe Priorität haben muss. Neben den zweifellos wichtigen ökonomischen Aspekten ist auch die Frage, „wie wir mit künftigen Generationen umgehen und was wir ihnen übergeben“.
-
![© Helge Bauer Portraitfoto von Jürgen Mandl, Präsident WK-Kärnten]() „Der Wirtschafts- und Lebensstandort Kärnten ist auf eine sichere, ausreichende und klimafreundliche Energieversorgung angewiesen"
„Der Wirtschafts- und Lebensstandort Kärnten ist auf eine sichere, ausreichende und klimafreundliche Energieversorgung angewiesen"Jürgen Mandl, Präsident WK-Kärnten
Stolpersteine beim Ausbau der Erneuerbaren in Kärnten
Wie weit der Weg noch werden kann, um die bereits definierten Ausbauziele zu erreichen und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien darüber hinaus zu realisieren, zeigt sich an der jüngst abgehaltenen Volksbefragung zur Windkraft in Kärnten sowie an einer aktuellen Studie.
Die zehnte Ausgabe der Erneuerbare Energien Studie von Deloitte, Wien Energie und der WU Wien zeigt, dass nach einem Allzeithoch 2022 die Akzeptanz der Bevölkerung bei Erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr weiter abgenommen hat.
Zwar zeigt sich, dass die österreichische Bevölkerung den Klimawandel als das drängendste Problem der nächsten Jahrzehnte erkennt, gleichzeitig ist sie jedoch seltener bereit, selbst Energiesparmaßnahmen umzusetzen.
Zudem werden erneuerbare Energieprojekte in der eigenen Umgebung kritischer gesehen.
Die beliebteste Form der erneuerbaren Energieerzeugung ist wieder die Photovoltaik, die jedoch von 89 Prozent Zustimmung 2022 auf 81 Prozent absackte.
An zweiter Stelle folgt die Kleinwasserkraft mit 69 Prozent Zustimmung gefolgt von der Windkraft, die 2022 noch 69 Prozent überzeugen konnte, im vergangenen Jahr jedoch nur mehr 60 Prozent.
Der Durchschnitt über alle erneuerbaren Energietechnologien sank von 79 Prozent 2022 auf 70 Prozent Zustimmung.
-
![© IV Kärnten Portraitfoto von Timo Springer, Präsident der IV Kärnten]() „Ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Erdgas wird nur gelingen, wenn wir die Erneuerbaren konsequent ausbauen“
„Ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Erdgas wird nur gelingen, wenn wir die Erneuerbaren konsequent ausbauen“Timo Springer, Präsident IV-Kärnten
Hitzige Diskussionen um Windkraft in Kärnten
Wie kritisch Windkraft zum Teil gesehen wird, zeigte sich jüngst bei der Volksbefragung in Kärnten. Diese wurde von der FPÖ und dem Team Kärnten initiiert. Die Vorbereitungen dafür begannen bereits im vergangenen Sommer. Der Volksbefragung ging eine hitzige Diskussion von Windkraftgegnern und Befürwortern voraus.
Auf der Seite der Befürworter standen neben den beiden in der Landesregierung vertretenen Parteien SPÖ und ÖVP auch alle anderen Parteien. Auch die Sozialpartner sowie deren Jugendorganisationen und viele zivilgesellschaftliche Organisationen sprachen sich für den Ausbau der Windkraft aus.
Aktuell gibt es in Kärnten zehn Windkraftanlagen, wobei Kleinwindkraftanlagen nicht miterfasst sind. Weitere acht Anlagen sind rechtskräftig genehmigt, in 15 weiteren Fällen liegt die Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht. Zudem laufen die Genehmigungsverfahren für weitere neun Anlagen.
Im vergangenen Herbst wurden erste Pläne präsentiert, in welchen Zonen Kärntens Windkraftanlagen möglich sein sollen. Die Pläne umfassen ein Gebiet von sieben Gemeinden oder 0,26 Prozent der Landesfläche. Entstehen würden rund neue 50 Windräder.
Verhärtete Fronten nach Kärntner Volksbefragung
Die Volksbefragung brachte bei einer Beteiligung von knapp 35 Prozent eine hauchdünne Mehrheit von 51,55 Prozent für das Verbot, was die Diskussion weiter anheizte.
Der Präsident der Kärntner Wirtschaftskammer, Jürgen Mandl, hielt fest, dass „der Wirtschafts- und Lebensstandort auf eine sichere, ausreichende und klimafreundliche Energieversorgung angewiesen“ sei.
Zudem handele es sich bei der Befragung um ein „undurchdachtes Foul an der Energiewende in Kärnten“, die „zwar kein aussagekräftiges Ergebnis, aber Millionenkosten für den Steuerzahler verursacht habe.“
Zudem führt Mandl aus, dass die Vorgehensweise ein klares Indiz dafür sei, dass es den Initiatoren von Anfang an nicht um die klare Feststellung des Bürgerwillens und einen sinnvollen Beitrag zur Kärntner Energiepolitik gegangen ist, sondern um parteipolitischen Radau unter Missbrauch des tief verwurzelten Heimatgefühls der Kärntnerinnen und Kärntner.
Die Wirtschaft wird ihren Kurs beibehalten, versicherte Mandl: „Wir werden weiterhin alles unternehmen, um einen Umbau unserer Energieversorgung weg von fossilen Energieträgern hin zu Erneuerbaren zu forcieren.“
Ähnlich äußerte sich auch die Industriellenvereinigung. „Wir respektieren das Ergebnis der Volksbefragung, sehen darin aber keine grundsätzliche Ablehnung neuer Technologien in Kärnten“, erklärte Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten. „Gerade im Winter, wenn die Sonnenstunden begrenzt sind, bietet die Windenergie eine verlässliche und notwendige Ergänzung im Energiemix,“ so Springer weiter.
Zudem wies die IV Kärnten auf ihre aktuelle Studie hin die zeigt, dass sich der Strombedarf der energieintensiven Industrie in Kärnten bis 2040 voraussichtlich verdoppeln wird. Rund 55 Prozent der Wertschöpfung und rund 100.000 Arbeitsplätze in Kärnten hängen am Industriesektor.
„Ein Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Erdgas wird nur gelingen, wenn wir die Erneuerbaren konsequent ausbauen. Wir brauchen vor allem Technologieoffenheit und Konzepte, wie wir den Energiebedarf sicherstellen können,“ führte der Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten weiter aus.
Auch die KELAG verlautbarte, das Ergebnis der Volksbefragung zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig wurde bekräftigt, weiterhin an einer zukunftssicheren Versorgung auf Basis erneuerbarer Energien zu arbeiten.
Der Verfassungsdienst des Landes Kärnten erklärte am Rande der überparteilichen Gesprächsrunden nach Vorliegen des Ergebnisses, dass ein Totalverbot von Windkraftanlagen rechtlich nicht zulässig ist.
Anfechtung der Volksbefragung
Unterdessen hat eine Wiener Kanzlei angekündigt, die Volksbefragung in Kärnten beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anzufechten. Florian Berl von Onz & Partner bestätigte am einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Berl, der auch mehrere Windparkbetreiber unter seinen Klienten hat, sieht vor allem in der Fragestellung ("Soll zum Schutz der Kärntner Natur [einschließlich des Landschaftsbildes] die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?") Anknüpfungspunkte für eine Anfechtung.
"Suggestivfragen bei einer Volksbefragung sind unzulässig", erklärte Berl im APA-Gespräch. Eine solche könne aber hier gegeben sein, weil in der Frage eine Verknüpfung zwischen dem "unzweifelhaft wichtigen Naturschutz einerseits und Windrädern andererseits" gegeben sei. Oder einfach ausgedrückt: "Die Befragten mussten sich entscheiden: Entweder Naturschutz oder Windkraft. Das ist etwas, das ich als wertende Fragestellung betrachte."
Ein weiterer Anknüpfungspunkt sei, dass die Regionen "Berge" und "Almen" nicht eindeutig abgegrenzt worden seien. Aus der Fragestellung sei außerdem nicht klar hervorgegangen, ob man über ein generelles Windkraftverbot in Kärnten oder nur auf Bergen und Almen abstimmt. Die Anfechtung, mit der die Befragung für nichtig erklärt werden soll, werde kommende Woche eingebracht, mit einer Entscheidung wird nicht binnen eines Jahres gerechnet. (apa/red)
🎙️ Wirtschaft im Ohr – Ihr Wissensvorsprung! 🚀
Jetzt den neuen Wirtschafts-Nachrichten Podcast entdecken: Aktuelle Trends, Expert:innen-Insights & spannende Analysen – kompakt & auf den Punkt. 🎧
🔊 Jetzt reinhören: wirtschafts-nachrichten.at/podcasts