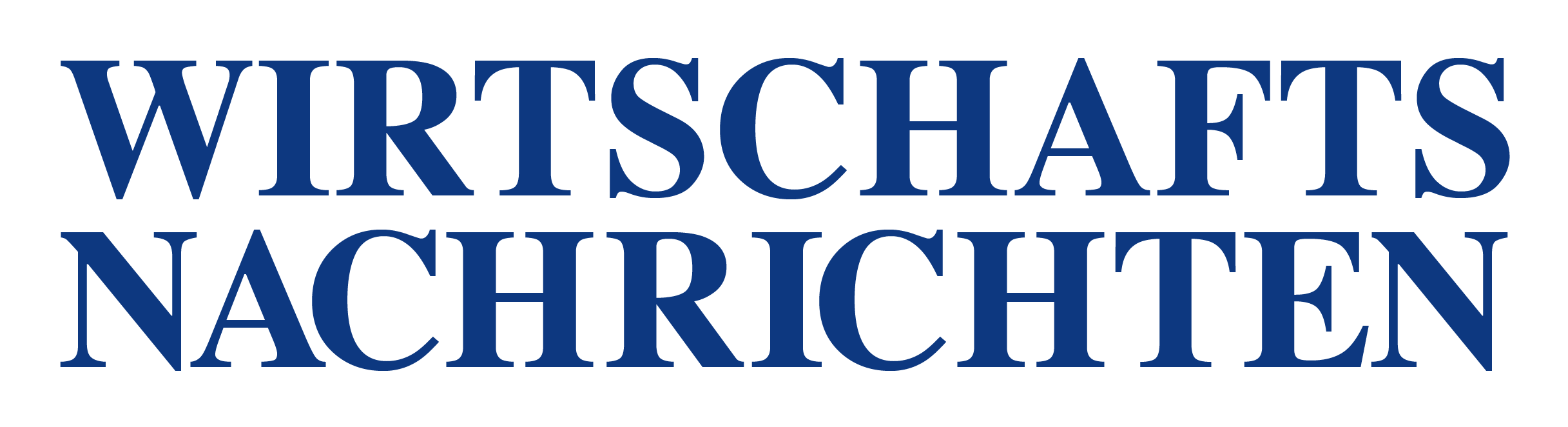Entwaldungsverordnung : Entwaldung: Lichtung des Bürokratiedschungels

Die Entwaldungsverordnung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Produkte in den Binnenmarkt kommen oder exportiert werden, für deren Herstellung es zu einer dauerhaften Entwaldung kam.
- © blende11.photo - stock.adobe.comDie vergangene EU-Kommission hat als Leuchtturmprojekt das „Fit for 55“-Paket geschnürt. Es hat zum Ziel, die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich alle 27 Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Teil dieses Pakets ist beispielsweise das Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren; aber auch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III, welche im November in Kraft trat. Diese baut auf den Richtlinien von 2009 und 2013 auf und legt als Hauptziel verbindlich fest, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch auf EU-Ebene bis 2030 statt bisher 32 Prozent mindestens 42,5 Prozent betragen soll.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Der Beschlussfassung ging eine hitzige Diskussion über die Nutzung von Biomasse voraus. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die Nutzung von Biomasse auf dem Durchschnittsniveau der Jahre 2017 bis 2022 zu belassen. Das sorgte vor allem deshalb für Kontroversen, da das EU-Parlament im Herbst 2022 Atomenergie und Gas als grün und nachhaltig eingestuft hat.
Das wurde revidiert und somit gilt Energieholz weiterhin als erneuerbar. Gleichzeitig wurden auch strengere Nachhaltigkeitskriterien für Biomasse implementiert.
Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch auf EU-Ebene soll bis 2030 statt bisher 32 Prozent mindestens 42,5 Prozent betragen.
Die Entwaldungsverordnung
Kontroversiell ging auch die Abstimmung über Änderungen zur EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) im EU-Parlament zu. Eigentlich sah der Vorschlag der EU-Kommission vor, nur den Geltungsbeginn der Verordnung, die bereits in Kraft ist, um ein Jahr zu verschieben. So sollte die Marktteilnehmer sich besser darauf einstellen können.
Doch von Seiten der Europäischen Volkspartei wurden Abänderungsanträge eingebracht, von denen einige eine Mehrheit fanden.
Die Entwaldungsverordnung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Produkte in den Binnenmarkt kommen oder exportiert werden, für deren Herstellung es zu einer dauerhaften Entwaldung kam. Solche Produkte waren in erster Linie Holz wie auch Soja, Fleisch, Kaffee, Kakao oder Kautschuk.
Vorgesehen war, dass die EU-Kommission Länder und Regionen in drei Kategorien einordnen kann: geringes, normales oder hohes Entwaldungsrisiko. Durch die Abänderung kam eine weitere Kategorie hinzu, nämlich jene, in der es kein Entwaldungsrisiko gibt.
Diese Kategorisierung zieht unterschiedliche Kontrollpflichten der Behörden wie auch unterschiedliche Pflichten für die betroffenen Unternehmen nach sich. Die Reaktionen auf diese Entscheidung waren gemischt.
„Die Holzindustrie begrüßt die Mehrheit im Europäischen Parlament, die EUDR inhaltlich zu verbessern“, sagt Herbert Jöbstl, Obmann des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs.
Erleichtert zeigt sich auch Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich: „Es ist erfreulich, dass endlich anerkannt wird, dass Länder wie Österreich, die einen nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten, nicht mit unverhältnismäßigem bürokratischem Aufwand belastet werden sollten.“
Entsetzt sind hingegen Umweltschützer. Der WWF ortet eine „Sabotage der EU-Entwaldungsverordnung“. Die NGO Südwind sprach von einer „umweltpolitischen Bankrotterklärung der Europäischen Union“.
Der Klimawandel führt in einigen Regionen dazu, dass der Wald temporär zur Kohlenstoffquelle statt zum -speicher wird.
Das Multitalent Wald steht stark unter Druck. In Zeiten des Klimawandels wird er immer wichtiger, da in Wäldern weltweit rund 30 Prozent der jährlich anfallenden CO2-Emissionen gebunden werden.
Zudem fungiert der Wald durch die Beschattung und Verdunstung wie eine natürliche Klimaanlage. Er schützt auch vor Auswirkungen des Klimawandels wie Muren, Hochwassern und Lawinen. Er fungiert als Wasserspeicher und Filter.
Andererseits machen dem Wald trockene Hitzesommer mit wenig Niederschlag ebenso zu schaffen wie Schäden durch Elementarereignisse wie Sturm oder Feuer, aber auch Schädlingsbefall wie durch den Borkenkäfer. Der sogenannte „Trockenstress“ begünstigt die Anfälligkeit für Schädlingsbefall noch zusätzlich.
Das führt mittlerweile dazu, dass in einigen Regionen der Wald temporär zur Kohlenstoffquelle statt zum -speicher wird. So war es beispielsweise in Deutschland oder Frankreich 2022 der Fall.
Der Klimawandel führt in einigen Regionen dazu, dass der Wald temporär zur Kohlenstoffquelle statt zum Speicher wird.
Österreich: Land der Wälder
Weltweit geht die Waldfläche zurück, für deren Schutz die Verordnung auch gedacht ist. In Österreich wie auch in Europa nimmt sie hingegen zu. In der EU ist die Waldfläche seit 1990 um 14 Millionen Hektar gewachsen, in Österreich beträgt das jährliche Wachstum rund 4.000 Hektar.
So kam es seit den 1960er Jahren zu einem Zuwachs im Ausmaß von 300.000 Hektar. Während österreichweit knapp die Hälfte des Landes mit Wald bedeckt ist, liegen einige Bundesländer darüber.
Die Steiermark ist laut der Waldinventur 2021 mit einem Waldanteil von 61,8 Prozent Spitzenreiter vor Kärnten, welches nur hauchdünn mit einem halben Prozent weniger an zweiter Stelle liegt.
Österreichs Wälder sind so in der Lage, 26 Millionen Tonne CO2 zu speichern, was einem Drittel der jährlichen Treibhausgasemissionen des Landes entspricht. Dies gelingt jedoch nur, solange der Baum im Wachstum ist.
Um dies auch weiterhin gewährleisten zu können, ist eine nachhaltige Forstwirtschaft wichtig, die auch eine wirtschaftliche Nutzung beinhaltet. Essenziell ist die Aufforstung, aber auch, bedingt durch den Klimawandel, der Umbau von Nadelbaumforsten hin zu mehr Laubmischwäldern. Österreich wird somit wohl eines dieser Länder sein, welches die Voraussetzungen für die Kategorie „kein Entwaldungsrisiko“ erfüllt.
Brennstoff Holz
Neben der Verwendung von Holz als Bau- und Grundstoff ist es auch als Energieträger immer wichtiger geworden. Laut den Basisdaten der Bioenergie Österreich 2023 ist Biomasse mit 55 Prozent der wichtigste erneuerbare Energieträger in Österreich.
Der Anteil bei der Wärmeerzeugung beträgt knapp 40 Prozent, jener der Stromerzeugung liegt bei sechs Prozent. Diese Nachnutzung ist im Lichte jährlich steigender Schadholzmengen in Folge von Witterung und Schädlingsbefall wichtig. Bundesweit stieg die Schadholzmenge zuletzt um fast ein Viertel.
Ob dieser Schritt des EU-Parlaments zum Bürokratieabbau tatsächlich bestehen bleibt, entscheidet sich in den Trilog-Verhandlungen mit Kommission und Rat. Die neue Kommission würde damit jedenfalls eines ihrer zentralen Wahlversprechen zeitnah erfüllen: Bürokratieabbau.