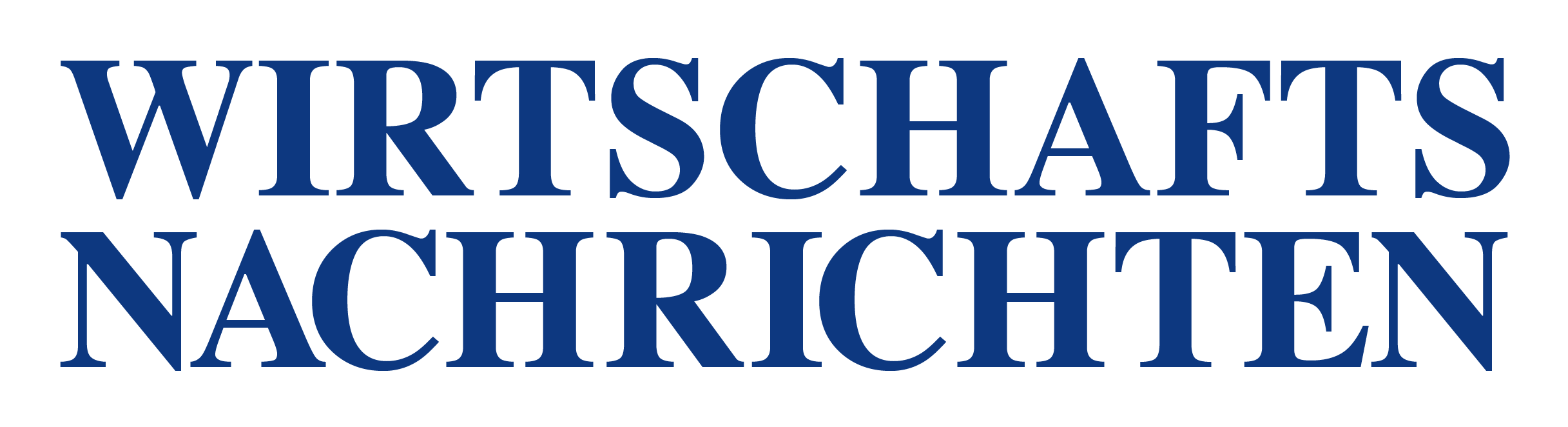EU Kriegswirtschaft : Europa auf dem Weg in die Kriegswirtschaft
Inhalt
- Rüstungsausgaben EU+NATO im Vergleich
- „ReArm Europe“ wird zu „Readiness 2030“
- Kriegsbereit bis 2030
- Das D.I.M.E.-Prinzip
- Defizite nicht nur bei Rüstung
- Spekulation und Ukraine-Krieg als Sicherheitsgarantie?
- Wie das Aufrüstungspaket der EU funktioniert
- Weitere Finanzierungsmittel
- Kritik an Verteidigungsbudgets
- Waffen statt Wohlstand: die Gefahr der „Überrüstung“

Geht es ums Geld, so ist die NATO Russland weit überlegen. Doch finanzielle Mittel sind offensichtlich nicht alles.
- © Adobe Stock/ChinnachoteAus unserer exklusiven Serie zur RÜSTUNGSWIRTSCHAFT
Ausgerechnet für die gemeinsame Aufrüstung hat man sich in Brüssel auf das bislang größte Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union geeinigt. Und dabei gab es in den letzten Jahren viele Milliardenpakete.
Mit 800 Milliarden Euro soll Europas Sicherheits- und Verteidigungsstruktur bis 2030 „kriegsfähig“ gegen Russland gemacht werden. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin die Militarisierung eines wirtschaftlichen und politischen Staatenbundes, dessen Struktur einst von den Gründervätern auf die Verhinderung von Kriegen ausgerichtet wurde.
Nun soll der Umbau der europäischen Wirtschaft in eine Kriegsökonomie vorangetrieben werden.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Rüstungsausgaben EU+NATO im Vergleich
Angaben in Milliarden US-Dollar
USA: 919
EU+GB: 350
Russland: 126
China: 296,44
Quelle: EDA, SIPRI, Jahr 2023/2024

„ReArm Europe“ wird zu „Readiness 2030“
Schon der Name des Aufrüstungsprogramms „ReArm Europe“ hat bei einigen Mitgliedsstaaten Unbehagen ausgelöst. Obwohl das EU-Parlament den Plänen bereits mehrheitlich zugestimmt hat, melden sich nun immer mehr Mitgliedstaaten kritisch zu Wort.
In den Niederlanden wurden die Aufrüstungspläne vom Parlament abgelehnt und Den Haag positioniert sich gegen Eurobonds, da eine Vergemeinschaftung der Schulden durch die Hintertür befürchtet wird.
Auf Drängen Spaniens und Italiens wurde der ursprüngliche Name des Programms „ReArm Europe“ in „Readiness 2030“ geändert, da ersterer zu militärisch und aggressiv klang.
„Ich mag das Wort Aufrüstung nicht. Die Europäische Union ist ein politisches Projekt, kein militärisches“, kritisierte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Der Begriff „ReArm Europe“ wecke daher falsche Assoziationen, die Legitimität des Programms könne bei den europäischen Bürgerinnen und Bürgern umstritten sein, wenn es zu einer Militarisierung der EU führe.
Tatsächlich ist die EU strukturell und organisatorisch nicht darauf ausgerichtet, komplexe Beschaffungsprozesse im Rüstungsbereich zu managen. Auch gibt es bisher keine ausreichenden Kontrollmechanismen, wie sie etwa der US-Kongress hat.
Brüssel versteigt sich dabei, etwas kontrollieren zu wollen, was zu sehr durch nationale Beschaffungsstrukturen in den Mitgliedsländern dominiert wird. Konflikte sind vorprogrammiert.
Kriegsbereit bis 2030
Die Umbenennung ändert jedoch nichts an der Grundidee der Aufrüstungspläne. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. März 2025 wurde deutlich gemacht, dass es darum geht, Europa innerhalb von fünf Jahren „kriegsfähig“ zu machen.
Lesen Sie auch hier: Wie Österreich hochfeste Verbundwerkstoffe für die Rüstungsindustrie herstellt
Das ist genau die Zeit, die Russland nach Einschätzung der EU-Kommission braucht, um seine Streitkräfte neu aufzustellen. Die Formulierung gibt zu denken. Geht Brüssel tatsächlich von einem „Krieg“ in fünf Jahren aus, für den man sich rüsten müsse, oder geht es um Investitionen in eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit, um Abschreckung zu erzeugen?
Die Sprache der EU-Eliten ist sehr unklar, missverständlich und im Ton strategisch unklug, wie viele Expertinnen und Experten inzwischen kritisieren. „Carry a big stick and speak softly, you will go far“, war ein Zitat des US-Präsidenten Theodore „Teddy“ Roosevelt, das dieser Tage im Zusammenhang mit den Aufrüstungsplänen der EU oft zitiert wird.
Das D.I.M.E.-Prinzip
Denn Aufrüstung allein ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Für eine echte Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der EU bedürfe es eines Ansatzes, der auf dem D.I.M.E.-Prinzip beruhe:
- Diplomacy: Vertretung geostrategischer und geoökonomischer Interessen durch resiliente Diplomatie, vorantreiben von Bündnis- und Vertragspolitik sowie aktive Verhandlungsteilhabe zur Schaffung einer vertraglichen Sicherheitsarchitektur.
- Information (Intelligence): Öffentlichkeitsarbeit, resiliente Medien, Schaffung einer Deutungshoheit und Informationsdurchdringung zur Projektion von Softpower, nachrichtendienstliche Abwehrfähigkeit.
- Military: Aufbau personeller und materieller sowie technologischer Abwehrkapazitäten und Schaffung eines Abschreckungspotenzials.
- Economy/Wirtschaft: aktive und geostrategisch ausgerichtete Handelspolitik, Schaffung von resilienten Wirtschaftskapazitäten sowie fiskal- und geldpolitische Voraussetzungen.
Defizite nicht nur bei Rüstung
Eine wirkliche Sicherheitsstrategie könne aber nur durch eine Erhöhung der Resilienz in all diesen Bereichen erreicht werden. So kritisieren viele Experten, dass die Europäische Union vor allem die Fähigkeit entwickeln müsse, eine Sicherheitsarchitektur auf dem Verhandlungsweg aufzubauen.
Einer der schärfsten Kritiker des derzeitigen EU-Kurses ist der weltbekannte Ökonom und Regierungsberater Jeffrey Sachs, der auch in Österreich regelmäßiger Gast beim jährlichen Europäischen Forum Alpbach ist. In einer Rede vor dem EU-Parlament forderte er Ende Februar 2025 eine „Geopolitik des Friedens“ von der europäischen Politik.
Der hochdekorierte Columbia-Professor beriet die russische Regierung beim wirtschaftlichen Transformationsprozess nach dem Zerfall der UdSSR. Er attestiert der EU, die Ursachen des Ukraine-Krieges falsch analysiert und daraus die falschen Schlüsse gezogen zu haben. Und er rät Europa zu mehr außenpolitischer Unabhängigkeit von den USA, die den Konflikt mit Russland maßgeblich provoziert hätten.
-
![© Von Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres - FMSTAN & SPIDER Global meeting in Austrian Foreign Ministries in Vienna, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86200269 Portraitbild von Ökonom Jeffrey Sachs]() Europa braucht eine Geopolitik des Friedens
Europa braucht eine Geopolitik des Friedensfordert Jeffrey Sachs unlängst
Spekulation und Ukraine-Krieg als Sicherheitsgarantie?
So seien die massiven Aufrüstungspläne vor allem auf Geheimdienstberichte mehrerer EU-Staaten zurückzuführen, wonach Russland in fünf Jahren die potenzielle Stärke erreicht habe, ein weiteres EU-Land anzugreifen.
An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass diese Einschätzungen auf Spekulationen beruhen und keinen Beweis für russische Handlungsabsichten darstellen. US-Dienste halten einen Angriff auf die EU oder die NATO für unwahrscheinlich. Im „Annual Threat Assessment“ von 2024 heißt es, der Kreml sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ nicht an einem direkten militärischen Konflikt mit den Streitkräften der USA und der NATO interessiert.
Vielmehr werde er seine asymmetrischen Aktivitäten unterhalb der Schwelle fortsetzen, die einen offenen Konflikt auslösen würde. Der deutsche BND scheint dies grundsätzlich anders zu sehen.
Nach Einschätzung von BND-Chef Bruno Kahl will Russland die Geschlossenheit des Westens auf die Probe stellen – insbesondere mit Blick auf den NATO-Beistandsartikel. In Russland gebe es Überlegungen, den NATO-Artikel 5 zu „testen“. Der BND-Chef macht auch deutlich, dass ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine Russland eher in die Lage versetzen würde, gegen Europa vorzugehen.
Diese Einschätzung des BND wirft die Frage auf, ob maßgebliche Kreise der europäischen Politik einen Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges in der Ukraine aus eigenen Sicherheitsinteressen hinauszögern wollen. Eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine wäre nach dieser Logik eine Sicherheitsgarantie für die baltischen Staaten.
Es stellt sich daher die berechtigte Frage, auf welchen Einschätzungen und Analysen die aktuelle Bedrohungslage durch Russland eigentlich beruht und wie verlässlich diese sind. Vieles, worauf die europäische Politik derzeit reagiert, beruht auf spekulativen Annahmen.
Wie das Aufrüstungspaket der EU funktioniert
2025 sollen 150 Milliarden durch Anleihen, zusätzliche Schulden und Umschichtungen im EU-Haushalt aufgebracht werden. Dieses Instrument mit dem Namen „Security and Action for Europe“ (SAFE), das noch im Detail beschlossen werden muss, soll vor allem gemeinsame Beschaffungen von mindestens zwei Ländern unterstützen.
Voraussetzung ist also, dass sich die EU-Länder zu Einkaufsgemeinschaften zusammenschließen. „Made in Europe“ soll dabei bevorzugt werden. Immer wieder wird eine Zahl von rund 60 Prozent europäischer Wertschöpfung genannt. In der Praxis ist dies jedoch umstritten.
Das neue EU-Weißbuch zur Verteidigung listet Maßnahmen auf, die gefördert werden können. Das sind zum Beispiel Luft- und Raketenabwehr, Artilleriesysteme, Flugkörper und Munitionsdrohnen sowie Drohnenabwehrsysteme, aber auch Cyberabwehr und militärische Mobilität.
Die restlichen 650 Milliarden Euro sollen rein rechnerisch durch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedsländer auf mindestens 1,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts aufgebracht werden. Da aber viele Länder bereits hoch verschuldet sind, sollen die Schuldenobergrenzen des europäischen Stabilitätspaktes für Rüstungsgüter ausgesetzt werden.
Weitere Finanzierungsmittel
Darüber hinaus gibt es weitere Töpfe, aus denen die Rüstungsindustrie schöpfen kann.
Das sind etwa die Kohäsionsmittel für Forschung und Entwicklung sowie für industrielle Investitionen, die Pesco-Mittel oder der Europäische Verteidigungsfonds EDF (13 Milliarden Euro) und die Europäische Friedensfazilität EPF (rund 5 Milliarden Euro).
Weiters beabsichtigt die Europäische Investitionsbank EIB, ihre jährlichen Investitionen auf zwei Milliarden Euro zu verdoppeln.
Kritik an Verteidigungsbudgets
Die Aufbringung der 800 Mrd. Euro ist vorerst rein rechnerisch und hängt stark von der Budgetentwicklung in den Mitgliedstaaten ab.
Da aber die Steuereinnahmen aufgrund der anhaltenden Rezession in Europa rückläufig sind, können die Verteidigungsbudgets in den meisten Ländern (so auch in Österreich) mittelfristig nur durch Ausgabenumschichtungen erhöht werden.
Kritiker befürchten, dass dies zu Lasten der Sozialausgaben oder der Infrastruktur gehen könnte. Zudem ist die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Mitgliedsländer umstritten und wird für Diskussionen sorgen.
Auch in der geplanten Mobilisierung des privaten Kapitalmarktes für den Rüstungssektor sehen Kritiker eine Verschiebung von Kapital, das in anderen zivilen Investitionsbereichen fehlen wird.
Waffen statt Wohlstand: die Gefahr der „Überrüstung“
Es mehren sich die Stimmen, die nicht nur eine Verlagerung von Kapital aus zivilen Bereichen in die Rüstungswirtschaft ausmachen, sondern auch vor einer teuren „Überrüstung“ warnen.
„Alles mit Geld zuzuschütten, ist nicht die Lösung. Europas Sicherheit hängt vor allem von intelligenter Aufrüstung und Kosteneffizienz ab“, sagt ein Berater aus der Rüstungsbranche gegenüber den Wirtschaftsnachrichten.
Am Geld allein kann es tatsächlich nicht liegen, wie die nackten Zahlen zeigen. Die NATO gibt jährlich über 1 Billion US-Dollar für Rüstung aus, Russland dagegen rund 126 Milliarden US-Dollar und China rund 300 Milliarden US-Dollar. Selbst kaufkraftbereinigt ist das eine deutliche monetäre Überlegenheit.
Die EU-Mitgliedsstaaten einschließlich Großbritanniens werden nach Angaben der EU-Verteidigungsagentur EDA im Jahr 2024 rund 350 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Gegenüber Russland besteht bereits heute eine deutliche finanzielle Überlegenheit. Dass sich dies nicht in mehr Sicherheit niederschlägt, liegt an teuren und langwierigen Beschaffungsprozessen und mangelnder Koordination.
Europas Hauptproblem sei, dass derzeit viel Geld für wenige teure Rüstungsgüter ausgegeben werde, machten mehrere Verteidigungsexperten deutlich.
„Wenn das nicht klug gemacht wird, laufen wir Gefahr, in die Rolle der UdSSR zu verfallen und uns auf Kosten unseres Wohlstands zu überrüsten“, so ein Verteidigungsexperte.
🔎 Noch mehr Wirtschaftseinblicke?
Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie über aktuelle Themen, spannende Interviews und Trends aus der Wirtschaft immer auf dem Laufenden! 🚀💼