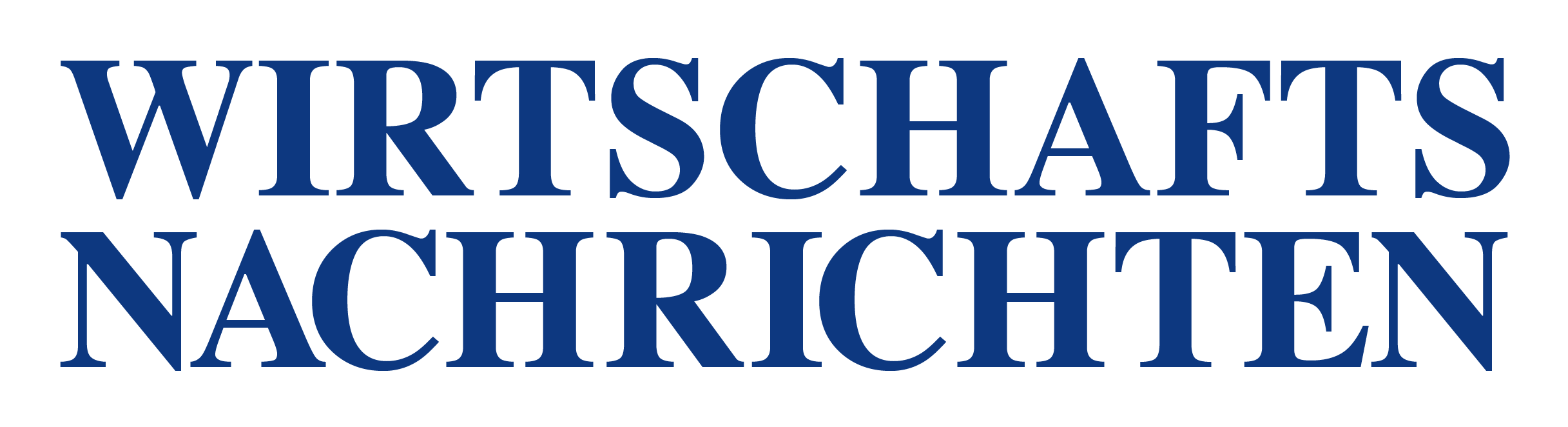Erneuerbare Energie Österreich : Die größten Projekte im Bereich Erneuerbare Energie

In Österreich stammt mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie aus Biomasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, der Landwirtschaft und Abfällen der Holz- sowie Lebensmittelproduktion gewonnen wird. Innovative Projekte wie das „Advanced Bioenergy Lab“ in Zeltweg fördern die Weiterentwicklung fortschrittlicher erneuerbarer Energien.
- © Maksym - stock.adobe.comIn Österreich laufen derzeit zahlreiche innovative Projekte, die den Übergang in eine klimaneutralen Energiezukunft ermöglichen. Diese Projekte zeigen, wie ein kluger Erzeugungsmix und ausreichend flexible Kapazitäten die Grundlage für eine nachhaltige Energieversorgung schaffen können.
Die E-Wirtschaft geht davon aus, dass sich der Strombedarf gegenüber heute auf rund 150 Terawattstunden verdoppeln wird. Vor allem die Bereiche Mobilität, Industrie und Raumwärme gewinnen dabei massiv an Bedeutung, neu hinzu kommt die Erzeugung von Wasserstoff.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Die politischen Ziele sind klar: Bis 2030 will Österreich seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen, bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Ein Unternehmen, das sich als wesentlicher Treiber dieser Transformation sieht, ist Verbund, der in seinen Kernmärkten Österreich und Deutschland 130 Wasserkraftwerke betreibt.
Wasserkraft ist die dominierende erneuerbare Energiequelle in Österreich. Derzeit stammen rund 61 Prozent der Stromproduktion aus Wasserkraftwerken. Verbund investiert massiv in die Modernisierung und den Ausbau von Pumpspeicherwerken.
„Aktuell stellen wir zwei alpine Pumpspeicher-Großbaustellen fertig. Limberg III in der Kraftwerksgruppe Kaprun mit 480 MW zusätzlicher Pumpspeicherleistung und Reißeck 2 plus in Kärnten mit 60 MW zusätzlicher Leistung", erklärt Verbund-Pressesprecher Ingun Metelko.
Weiters eröffnete das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Energie Steiermark kürzlich das elf MW Murkraftwerk Gratkorn. Insgesamt investiert Verbund rund 5,5, Milliarden Euro in die grüne Transformation.
Wenn die PV-Anlage schwimmen lernt
Ein Projekt, das national und international große Beachtung findet, ist die „Floating-PV-Anlage“ der EVN in Grafenwörth. Diese schwimmende Solaranlage ist mit Stand November 2024 die größte ihrer Art in Österreich und Mitteleuropa.
„Die Floating-PV-Anlage produziert rund 26.700 MWh Ökostrom pro Jahr und versorgt damit etwa 7.500 Haushalte. Die Installation der 45.304 PV-Module erfolgte in nur zehn Wochen“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach.
Die Anlage wurde auf stillgelegten Teichen einer ehemaligen Sand- und Kiesgrube errichtet und nutzt die kühlende Wirkung des Wassers, um die Energieeffizienz zu steigern. „Mit der Floating-PV-Technologie können wir im Vergleich zu einer herkömmlichen Freiflächenanlage auf gleicher Fläche fast die doppelte Leistung erzielen“, betont Zach.
Ein weiteres Plus: Floating-PV-Projekte benötigen weniger Platz und bieten damit eine zukunftsweisende Perspektive für großflächige Solarprojekte im Spannungsfeld zwischen Energieerzeugung und Flächennutzung.
Die EVN plant derzeit zwar keine weiteren schwimmenden Solaranlagen, baut aber ihre Freiflächenkapazitäten aus. „Bis 2030 wollen wir die PV-Leistung auf 300 MWp ausbauen und rund 100.000 Haushalte mit Sonnenstrom versorgen“, so Zach.
Die Energiewende in Österreich stellt das traditionell auf fossilen Energieträgern basierende Energiesystem vor große Herausforderungen. Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des Österreichischen Biomasse-Verbandes, betont die Rolle der Biomasse als effiziente und kostengünstige Energiequelle für die Wärmebereitstellung.
„Bioenergie ist in vielen Bereichen eine sehr effiziente und kostengünstige Energieform, insbesondere da die Speicherung von volatiler Energie über längere Zeiträume teuer und mit Energieverlusten verbunden ist", so Pfemeter.
Biomasse macht mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie in Österreich aus und stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, der Landwirtschaft sowie aus Abfällen der Holz- und Lebensmittelproduktion. Innovative Projekte wie das „Advanced Bioenergy Lab“ in Zeltweg treiben die Entwicklung fortschrittlicher erneuerbarer Energieträger voran.
„Dort wandelt ein Gaserzeuger verschiedene feste Biomassen in ein Gas um, das als Basis für flüssige Treibstoffe oder grüne Gase dient, die ins Erdgasnetz eingespeist werden können", erklärt Pfemeter.
Eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende ist BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage). Pfemeter sieht darin großes Potenzial: „BECCS ermöglicht die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff, was zu negativen Emissionen führt. Diese Technologie könnte bis 2040 zwischen fünf und zehn Millionen Tonnen negative Emissionen beisteuern."
Meilenstein für klimaneutrale Zukunft: GeoTief Wien
Die Energiewende braucht innovative Lösungen. Mit dem Projekt „GeoTief Wien“ hat Wien Energie einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige und klimaschonende Energiezukunft gesetzt. Das größte Geologie-Forschungsprojekt Österreichs hat die Basis für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Hauptstadt geschaffen.
„Geothermie, und speziell Tiefengeothermie, wird einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Fernwärme in Wien leisten", heißt es von Seiten des Unternehmens. Von 2016 bis 2022 wurde der Wiener Untergrund und die Heißwasservorkommen darin umfassend erforscht – ein wesentlicher Schritt, um die Technologie in die Praxis umzusetzen.
In Aspern errichten Wien Energie und OMV die erste Tiefengeothermieanlage Wiens mit einer Leistung von rund 20 Megawatt thermisch. Dazu haben die beiden Unternehmen das Joint Venture „deeep“ gegründet, das die Bohrungen durchführen und die Wärme in das Wiener Fernwärmenetz einspeisen soll.
„Mit dieser Anlage wollen wir künftig klimaneutrale Fernwärme für etwa 20.000 Haushalte erzeugen", so Wien Energie. Dazu werden Tiefenbohrungen in rund 3.000 Meter Tiefe vorgenommen, um das rund 100 Grad Celsius heiße Wasser zur Energiegewinnung zu nutzen. Nach dem Wärmeentzug wird das Wasser wieder in das Reservoir zurückgeleitet, sodass ein geschlossener Kreislauf entsteht.
Das Projekt, das bis 2028 abgeschlossen sein soll, ist bereits ein gutes Stück vorangekommen. „Noch in diesem Winter beginnen wir mit den Tiefenbohrungen“, heißt es von Wien Energie. Diese sollen bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. Danach folgen Fördertests, um die Eigenschaften des Formationswassers genau zu untersuchen. Die Errichtung der obertägigen Anlagen ist für 2026 geplant, die Inbetriebnahme für 2028.
Wenn von erneuerbaren Energien die Rede ist, darf die Windkraft nicht fehlen. Auch wenn sie nur rund elf Prozent zur österreichischen Stromerzeugung beiträgt. Ein bedeutendes Projekt ist der Windpark Handalm in der Steiermark, der mit 13 Windturbinen eine Gesamtleistung von 39 MW erreicht und jährlich rund 76 GWh grünen Strom produziert.
Leider sind neue Windkraftprojekte in Österreich aufgrund der Widmungs- und Genehmigungsverfahren sowie der oft fehlenden Akzeptanz in der Bevölkerung schwierig umzusetzen. Trotzdem will beispielsweise Verbund bis 2030 ein Viertel seines Stroms aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind erzeugen.
„Die Diversifizierung macht Sinn, weil sich die Erzeugungsportfolios der erneuerbaren Energien ergänzen“, so Verbund-Pressesprecher Ingun Metelko.
Auch die eigenen Windkraftkapazitäten der EVN werden bis 2030 nahezu verdoppelt. „Wir merken immer wieder, wie wichtig der direkte Kontakt mit den Menschen und eine proaktive Kommunikation sind, um unsere Projekte reibungslos umzusetzen“, so EVN-Pressesprecher Stefan Zach.