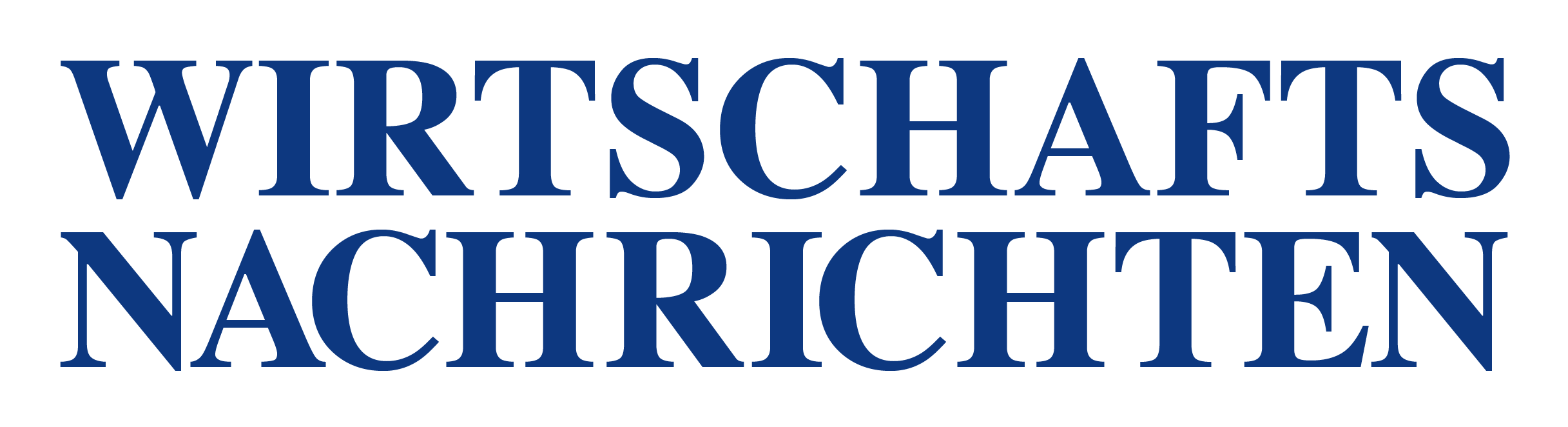Export Österreich : Ist der Freihandel tot und wer ist sein Nachfolger?

"Freihandel ist eine Idealvorstellung. Neben Zöllen gibt es zahlreiche andere Handelsbarrieren, die wir niemals ganz überwinden können."
- © kinara art design - stock.adobe.comIn dem neuen Buch „Der Freihandel hat fertig. Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet“ schreiben zwei Außenhandelsexperten über die internationale Lage. Ihre Namen: Gabriel Felbermayr, Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung, und Martin Braml, Dozent an der Universität Passau.
Langjährige Erfahrung in der Politikberatung lässt die Autoren bemerkenswerte Zusammenhänge erkennen, Irrglauben aufdecken und Wege zeigen, wie unser Wohlstand trotz widriger Umstände erhalten und ausgebaut werden kann.
Wirtschaftsnachrichten: Haben Sie mit dem Freihandel bereits abgeschlossen, weil Sie als Titel Ihres neuen Buches eine Abhandlung des legendären Trapattoni-Sagers „Habe fertig“ gewählt haben?
Was wir als abgeschlossen ansehen, ist die Zeit des naiven Freihandels; der Vorstellung nach 1990, dass „Wandel durch Handel“ die Welt ausschließlich friedlicher macht. Der freie Welthandel schafft einerseits Abhängigkeiten, die durch ruchlose Teilnehmer ausgenutzt werden – man denke an Putins Erdgaserpressungen und Getreideblockaden. Andererseits macht die Teilnahme am Welthandel alle Beteiligten reicher. Und nicht alle Profiteure nutzen diesen Reichtum zu friedvollen Zwecken.
Damit hat der Freihandel spürbare sicherheitspolitische Auswirkungen, die wir in den letzten Jahrzehnten sträflich missachtet haben. Übrigens nicht nur politisch, auch wir als Wissenschaftler müssen uns das eingestehen.
Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung!
Warum der Freihandel nicht einmal in der EU ganz funktioniert
Ist freier Handel in der Realität überhaupt möglich?
Freihandel ist eine Idealvorstellung. Neben Zöllen gibt es zahlreiche andere Handelsbarrieren, die wir niemals ganz überwinden können. Das Auseinanderfallen von Sprache und Kultur hat einen Einfluss auf grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit ebenso wie unterschiedliche Regulierungen, technische Standards und Umwelt- und Datenschutzauflagen. Und es ist ein wesentlicher Teil der nationalen Souveränität, dass wir letztere selbst regeln wollen und nicht global einheitlich.
Natürlich wären weitere integrative Schritte wünschenswert. Etwa durch die Ratifizierung des seit Jahren ausverhandelten Freihandelsabkommen der EU mit den lateinamerikanischen Staaten des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay).
Selbst der europäische Binnenmarkt bedeutet keinen idealtypischen Freihandel. Empirisch lässt sich beispielsweise nachweisen, dass EU-Binnengrenzen weiterhin wie ein Zoll in Höhe von 30-60 Prozent wirken und damit Handel vermindern. Handelsbarrieren sollten immer wohl überlegt sein, denn sie machen uns grundsätzlich ärmer.
Lesen Sie auch hier: Wie sich Europa neu erfinden kann – und muss

Österreich ist abhängig von offenen Märkten
Die Entkopplung Chinas und der USA von globalen Wirtschaftsprozessen ist zu beobachten. Auch innerhalb der EU werden Freihandelsabkommen zunehmend infrage gestellt. Was bedeutet das für den Export mittelstandsgeprägter und handelsorientierter Staaten wie Österreich, Deutschland oder die Schweiz?
Das Geschäftsmodell in den deutschsprachigen Ländern ist maßgeblich von möglichst freien und offen Märkten abhängig, und zwar in doppelter Weise. Einerseits sind wir auf Importe von Vorprodukten und Rohstoffen angewiesen. Andererseits benötigen die hiesigen Weltmarktführer globale Absatzmärkte, denn ohne sie lässt sich der hohe Grad an Spezialisierung nicht aufrecht erhalten.
Auch eigene Abschottungstendenzen sollten kritisch hinterfragt werden, denn Industriesubventionen, „Resilienzboni“, Lieferkettengesetze und Klimaprotektionismus rufen Reaktionen im Ausland hervor. Abschottungsspiralen drohen.
Dennoch können handelsbeschränkende Maßnahmen sinnvoll sein, zum Beispiel um Abhängigkeiten wie jene von Putins Gasexporten zu vermeiden, die uns erpressbar machen. Wir formulieren dazu knallharte Kriterien, welcher Güter als derart sensibel einzustufen sind.
Die allermeisten sind es übrigens nicht. Und für die Bereiche, bei denen wir solche sensiblen Abhängigkeiten feststellen, schlagen wir Lösungen vor, wie der Handel diversifiziert werden kann, ohne in plumpen Autarkismus zu verfallen.
Was Österreich als Exportland tun kann
Wenn aufgrund von Protektionismus einzelner Staaten die Fabriken nur mehr im eigenen Land gebaut werden, wird das Exportland Österreich dann sein Geschäftsmodell ändern müssen?
In der Tat, Firmen schützen sich vor Handelskriegen, indem sie ihre Produktion näher an die Absatzmärkte verlagern. Dies birgt allerdings auch das Risiko des Technologieabflusses mit sich, Stichwort Joint-Venture-Zwang in China.
Am Ende sind das betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Exportländer wie Österreich können dem entgegenwirken, indem sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten für möglichst freien und ungehinderten Handel eintreten, aber auch grundsätzlich für gute Rahmenbedingungen im Inland sorgen, damit Unternehmen investieren wollen.
Ein bedeutender Teil des internationalen Handels für Österreich ist übrigens auch der Tourismus. Technisch gesprochen handelt es sich dabei um Dienstleistungsexporte. Eine Standortverlagerung droht dabei Gott sei Dank nicht.
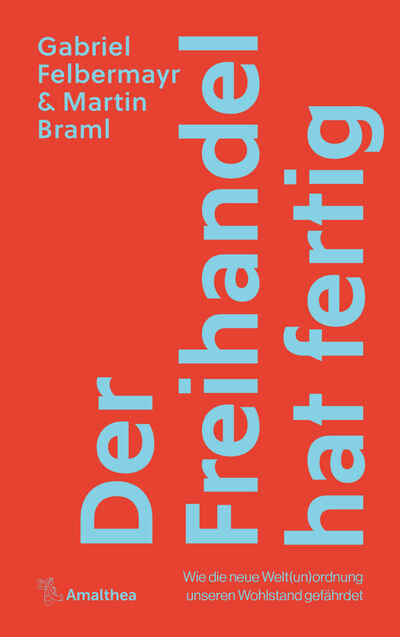
Woher künftiges Wachstum kommen soll
Ist unser bisheriger Wohlstand in Österreich und auch Deutschland auf Dauer zu halten?
Womöglich stellt sich vor allem die Frage, wo künftiges Wachstum herkommen soll, denn auch eine Dauerstagnation kann nicht unser Ziel sein.
Und dabei stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen: die demographische Dividende ist erschöpft, denn in den nächsten Jahren gehen die starken Jahrgänge in Pension.
Sicherheitspolitisch zeigt sich, dass auch die Friedensdividende erschöpft ist und mehr für die eigene Wehrhaftigkeit getan werden muss.
Und drittens gibt es Gegenwind bei der Globalisierung, die unser Wachstum lange mitgetragen hat. Fiskalische Spielräume sind ohnehin schon eng und werden in den nächsten Jahren noch kleiner.
Das alles trifft auf Österreich und Deutschland, aber grundsätzlich auch auf Europa insgesamt zu. Positiv spricht für uns, dass wir weiterhin in vielen Technologiebereichen führend sind, und diese technologische Führerschaft sollten wir versuchen auszubauen.
Die Gefahr der Handelskriege
Müssen wir uns in Zukunft für Handelskriege rüsten?
Ja. Aber insbesondere dazu, um sie zu verhindern. Wir sollten die Handelskrieger dieser Welt – ob sie Trump oder Xi heißen – wissen lassen, dass wir uns wehren können.
Auf die USA unter Trump hatte das schon einmal Wirkung, hier hat die entschlossene Reaktion der EU auf Zölle mit Gegenzöllen zu reagieren am Ende zu einem Einfrieren der Streitigkeit geführt.
Handel schafft immer wechselseitige Abhängigkeiten und ein großer Teil unserer Exporte ist eben nicht so einfach für die Importeure zu ersetzen, weil wir hoch spezialisierte Dinge produzieren. Erdgas aus Russland kann man mit Erdgas aus Katar oder Norwegen eins zu eins ersetzen. Für Maschinen, Medizingüter, Sensorik, optische Geräte usw. ist das nicht so einfach möglich.
Bestenfalls genügt die Androhung von Sanktionen, um Handelskriege zu vermeiden. Aber eben nicht immer. Dazu müssen wir auch unser Mindset ändern: Traditionell begreifen wir Handel nur in sehr seltenen Fällen als Waffe, man denke an Embargos gegen Nordkorea oder den Iran.
Dies werden wir nun häufiger tun müssen, weil die Welt eben eine immer weniger friedliche ist. Unsere Handelspartner sind uns nicht zwingend wohl gesonnen, nur weil sie Geschäfte mit uns machen.

Idee und Prognose für die Zukunft
Sie fordern eine Art „Wirtschafts-NATO“ um Machthabern, die mit der Verhängung von Straf-Zöllen drohen, Paroli bieten zu können. Wie könnte das funktionieren?
Dabei geht es um folgendes: Demokratien sind untereinander sehr friedlich, sowohl militärisch, aber auch handelspolitisch. Dies schließt Handelsstreitigkeiten nicht aus. Strategische Abhängigkeiten zu schaffen, um diese erpresserisch zu nutzen, kennen wir nur von Autokratien.
Unser Vorschlag ist, dass sich die westlich geprägten Demokratien dieser Welt wirtschaftlich beliebig eng miteinander verflechten können, ohne dass dies zum Sicherheitsproblem wird. Das sollte auch nicht auf den euro-atlantischen Raum begrenzt sein, sondern schließt Länder wie Australien, Japan, Südkorea oder Taiwan explizit mit ein.
Ähnlich wie im Kalten Krieg sollten diese Staaten ihre Technologieexporte an Dritte koordinieren, denn gemeinsames Ziel sollte sein, die Technologieführerschaft auf möglichst vielen Bereichen zu erhalten. Auf handelspolitische Erpressungen von Dritten könnte man ebenfalls mit einer gemeinsamen Antwort reagieren.
Dürfen wir in eine optimistische demokratische Zukunft mit Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft blicken oder können Sie eine solche Perspektive nicht erkennen?
Doch, das dürfen wir. Wir neigen ja gelegentlich dazu, uns selbst immer zu negativ zu sehen. Putins Russland ist moralisch bankrott, ein Polizeistaat nach innen, wirtschaftlich abhängig von China und militärisch nun sogar vom Iran und Nordkorea. In China gibt es ebenfalls erhebliche demographische und zunehmend auch wirtschaftliche Probleme.
Wir dürfen nicht vergessen: Das chinesische Pro-Kopfeinkommen liegt in etwa auf dem Niveau Bulgariens, dem ärmsten Land der EU. Zum Aufschließen des hiesigen Wohlstandsniveaus ist es noch ein langer Weg und großspurige Ziele der chinesischen Regierung werden nicht erreicht, etwa bei der Seidenstraßeninitiative oder der Industriestrategie Made in China 2025.
Blickt man auf die internationalen Migrationsströme zeigt sich auch eindeutig, dass der „Westen“ im Sinne des Dreiklangs aus Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Marktwirtschaft den meisten Menschen noch immer als die attraktivste Staats- und Gesellschaftsform erscheint.